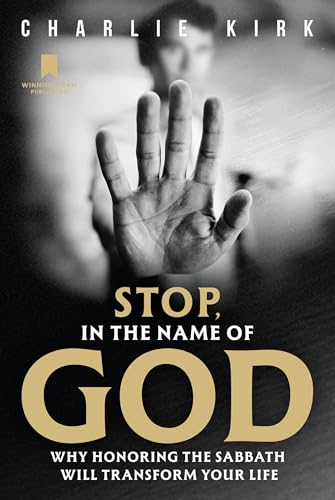Player FM - Internet Radio Done Right
32 subscribers
Checked 12d ago
تمت الإضافة منذ قبل five أعوام
المحتوى المقدم من Katja Diehl. يتم تحميل جميع محتويات البودكاست بما في ذلك الحلقات والرسومات وأوصاف البودكاست وتقديمها مباشرة بواسطة Katja Diehl أو شريك منصة البودكاست الخاص بهم. إذا كنت تعتقد أن شخصًا ما يستخدم عملك المحمي بحقوق الطبع والنشر دون إذنك، فيمكنك اتباع العملية الموضحة هنا https://ar.player.fm/legal.
Player FM - تطبيق بودكاست
انتقل إلى وضع عدم الاتصال باستخدام تطبيق Player FM !
انتقل إلى وضع عدم الاتصال باستخدام تطبيق Player FM !
المدونة الصوتية تستحق الاستماع
برعاية
O
On the Bus with Troy Vollhoffer

1 From Hockey Fights to Festival Nights with Troy Vollhoffer 38:51
38:51  التشغيل لاحقا
التشغيل لاحقا  التشغيل لاحقا
التشغيل لاحقا  قوائم
قوائم  إعجاب
إعجاب  احب38:51
احب38:51
After realizing his dreams of playing in the NHL might not happen, Troy Vollhoffer went from scrapping with the captain of the Boston Bruins to fighting to get his production company off the ground. After decades of putting on the largest country music festivals in the world, Troy Vollhoffer has no signs of slowing down. It’s a special episode of On The Bus, as Country Thunder CEO Troy Vollhoffer hands the wheel over to his good friend Nick Meinema. Growing up in an entertainment household is how Troy got bit by the showbiz bug. Troy reveals to Nick how he went from poolside milkshakes with Redd Foxx to growing up and overseeing the longest-running country music festival in North America. Nick has Troy share some of his favorite Country Thunder moments and reflect on how special it is to work with megastars like Reba McEntire, George Strait, and Taylor Swift.…
she drives mobility
وسم كل الحلقات كغير/(كـ)مشغلة
Manage series 2812748
المحتوى المقدم من Katja Diehl. يتم تحميل جميع محتويات البودكاست بما في ذلك الحلقات والرسومات وأوصاف البودكاست وتقديمها مباشرة بواسطة Katja Diehl أو شريك منصة البودكاست الخاص بهم. إذا كنت تعتقد أن شخصًا ما يستخدم عملك المحمي بحقوق الطبع والنشر دون إذنك، فيمكنك اتباع العملية الموضحة هنا https://ar.player.fm/legal.
On the way to new mobility: Katja Diehl spricht alle 14 Tage mit Gästen über Mobilität statt Verkehr, Diversität, New Work, Inklusion, kindergerechte Stadt und das Mobilisieren auf dem Land.
…
continue reading
172 حلقات
وسم كل الحلقات كغير/(كـ)مشغلة
Manage series 2812748
المحتوى المقدم من Katja Diehl. يتم تحميل جميع محتويات البودكاست بما في ذلك الحلقات والرسومات وأوصاف البودكاست وتقديمها مباشرة بواسطة Katja Diehl أو شريك منصة البودكاست الخاص بهم. إذا كنت تعتقد أن شخصًا ما يستخدم عملك المحمي بحقوق الطبع والنشر دون إذنك، فيمكنك اتباع العملية الموضحة هنا https://ar.player.fm/legal.
On the way to new mobility: Katja Diehl spricht alle 14 Tage mit Gästen über Mobilität statt Verkehr, Diversität, New Work, Inklusion, kindergerechte Stadt und das Mobilisieren auf dem Land.
…
continue reading
172 حلقات
ทุกตอน
×s
she drives mobility
1 „Grüner Kolonialismus – Wie der globale Norden den Süden unter grünem Deckmantel weiter ausbeutet.“ 52:47
52:47  التشغيل لاحقا
التشغيل لاحقا  التشغيل لاحقا
التشغيل لاحقا  قوائم
قوائم  إعجاب
إعجاب  احب52:47
احب52:47
Der September-Partner von She Drives Mobility sind die Energiewerke Schönau (EWS). Wenn auch du ein Unternehmen hast, das zu meinen Themen passt, melde dich gern – ob als Gast oder Werbepartnerin. Schön, dass du reinschaltest! Meine Arbeit generiert dir Mehrwerte? Dann freue ich mich über deinen Support! Meinen wöchentlichen Newsletter gibt es bei steady . Es gibt es mein erstes Kinderbuch ! Und ab sofort vorbestellbar: „Picknick auf der Autobahn.“ In unserem hoffnungsfrohen Buch bieten wir konkrete und detaillierte Antworten und somit Doping für unsere Vorstellungskraft. Meinen Podcast schon abonniert? Wenn dir diese oder auch eine andere Folge gefällt, lass´ gern eine Bewertung da und/oder supporte mich per Ko-Fi oder PayPal . Anfragen an hallo@mmw-voices.de . Diese Episode ist ein Weckruf für alle, die Mobilität, Klimapolitik und technologische Transformation ernsthaft global und gerecht denken wollen. Ich spreche mit der Soziologin Dr. Miriam Lang, die in Quito (Ecuador) lehrt und zu den profiliertesten Stimmen gehört, wenn es darum geht, die strukturellen Ungleichheiten zwischen Nord und Süd unter dem Deckmantel grüner Politik aufzudecken. Sie ist Mit-Herausgeberin des internationalen Sammelbands Grüner Kolonialismus , der inzwischen auch auf Deutsch erschienen ist und vielbeachtet wurde. Gemeinsam sprechen wir darüber, warum „grüne Lösungen“ wie E-Mobilität, Wasserstoffprojekte oder der Abbau von Lithium oft nichts anderes sind als eine Fortsetzung kolonialer Ausbeutung mit neuen Mitteln. Themen dieser Episode: Fallstudien und toxische Strukturen Wie „grüne“ Projekte im Globalen Süden – etwa der Lithiumabbau in Südamerika, Windparks in Namibia oder Solarprojekte im Maghreb – lokale Gemeinschaften massiv beeinträchtigen und durch Enteignung, Wassermangel und Missachtung indigener Rechte Ausbeutung fortsetzen. Welche Rolle der sogenannte „ökologische Imperialismus“ spielt: Das Rechtfertigungsnarrativ, das „grüner Energie“ alles erlaubt – ohne zu hinterfragen, wie sie gewonnen wird und ihren Verbrauch einzuhegen. Machtverhältnisse und koloniale Kontinuitäten Inwiefern die heutige Klimapolitik und Technologieförderung koloniale Strukturen reproduzieren. Wie multilaterale Handelsabkommen, Rohstoff-Abhängigkeiten und makroökonomische Regeln aus der Sicht des Globalen Südens gestaltet sind – und wie Alternativen aussehen könnten. Warum sich Konzerne und politische Institutionen mit dem Begriff „grün“ moralisch aufwerten, während die Auslagerung ökologischer Kosten unserer Lebensweise in andere Weltregionen weiterläuft. Gerechtigkeit und Widerstand Welche globalen, dezentralen und demokratischen Ansätze das Buch als Alternativen vorstellt: Bioregionale Kreisläufe, Energiekooperativen, Commons-basierte Ansätze, Klimareparationen. Warum indigene und ländliche Gemeinschaften nicht als „rückständig“, sondern als zentrale Akteure einer gerechten Zukunft verstanden werden. Warum der Begriff „Klimaneutralität“ oft eine rhetorische Fassade bleibt – und was echter Wandel bedeuten würde. Ob es bereits Positivbeispiele für gerechtere Klimapolitik gibt – und wo die größten Hebel liegen. Handlungsspielräume und Visionen Welche politischen Hebel demokratische Gesellschaften – und speziell die EU – jetzt in Bewegung setzen müssten, um grünen Kolonialismus zu stoppen. Was wir als Bürger*innen tun können: von Konsumkritik über kommunale Partnerschaften und Bürger*inneninitiativen für Klimagerechtigkeit von unten bis hin zu solidarischer Wissensarbeit. Warum Medien, Wissenschaft und Zivilgesellschaft eine neue Rolle einnehmen müssen – jenseits von Tech-Euphorie oder Schuldzuweisungen. Und schließlich: Was Miriam selbst Hoffnung gibt – und welche überraschenden Reaktionen sie auf das Buch bisher erlebt hat. Stimmen zum Buch Grüner Kolonialismus : „Eine unverzichtbare Lektüre für alle, die sich für eine Welt einsetzen, in der das Leben im Mittelpunkt steht.“ — Silvia Federici , feministische Autorin von Caliban und die Hexe „Eine postkarbonische Welt muss eine postkapitalistische Welt sein – dieses Buch sagt es klar.“ — Walden Bello , Globalisierungskritiker „Brillant und international – ein Kompass für gerechte Transformation.“ — Peter Newell , Professor für Internationale Beziehungen, Universität Sussex Diese Episode fordert uns heraus, den Begriff „Nachhaltigkeit“ neu zu denken – und endlich Verantwortung zu übernehmen für eine Transformation, die nicht auf Ausbeutung beruht. Empfehlung: Diese Folge eignet sich auch wunderbar für Bildungsarbeit, Diskussionen in Aktivismus-Kreisen, kommunale Partnerschaften oder Lesekreise zur globalen Klimagerechtigkeit.…
s
she drives mobility
1 Kommunikation, Verhalten & Verkehrswende – wie wir Menschen wirklich in Bewegung bringen! 38:09
38:09  التشغيل لاحقا
التشغيل لاحقا  التشغيل لاحقا
التشغيل لاحقا  قوائم
قوائم  إعجاب
إعجاب  احب38:09
احب38:09
Wie bringt man Menschen dazu, ihr Mobilitätsverhalten wirklich zu ändern? In dieser Folge spreche ich mit Eva Weber, Kommunikationsberaterin bei lots*, und Dr. Jutta Deffner , Leiterin des Forschungsfelds Nachhaltige Gesellschaft am ISOE , über Routinen, Widerstände – und wie Kommunikation der Schlüssel zur Verkehrswende wird. Sie berichten von ihrem Forschungsprojekt, das ein praxistaugliches Playbook hervorgebracht hat: ein Werkzeugkasten für alle, die Mobilität neu denken wollen. Mit vielen Aha-Momenten, Kritik am Deutschlandticket – und Mutmachgeschichten. Beide haben gemeinsam ein interdisziplinäres und praxisnahes Forschungsprojekt durchgeführt, das untersuchte, was Kommunikation zur Verhaltensänderung beitragen kann. Es entstand ein Playbook, das frei zugänglich für alle Interessierten ist. Von Routinen, Widerständen und Aha-Momenten Jutta erklärt, warum Routinen so mächtig sind und weshalb ein Bewusstsein für Probleme noch lange nicht bedeutet, dass Menschen ihr Verhalten ändern. Sie beschreibt, wie Infrastruktur, Kompetenzen und Motivation zusammenspielen müssen – und warum Kommunikation dabei nicht nachträglich, sondern von Anfang an Teil des Veränderungsprozesses sein sollte. Eva bringt die Perspektive aus der Praxis ein. Sie schildert, wie emotional das Thema Parkraum in Städten verhandelt wird („Parkraum ist das emotionalste Thema, das mir in der Arbeit begegnet“), wie groß die Angst von Verwaltungen und Politik vor Widerständen ist – und wie entscheidend es ist, die Veränderungsbereitschaft der Zielgruppen wirklich zu verstehen. Ein Satz, den sie im Projekt immer wieder gehört hat: „Das haben wir ja noch nie so gemacht.“ Das Playbook – ein Werkzeugkasten für die Verkehrswende Aus der Zusammenarbeit von Kommunikationsprofis, Sozialwissenschaft, Umweltpsychologie und Praxispartnern ist ein Framework entstanden, das Schritt für Schritt zeigt, wie man Kommunikation für Verhaltensänderungen gestaltet: Zielgruppen identifizieren Veränderungsziel schärfen Maßnahmen entwickeln Wirksamkeit evaluieren Klingt selbstverständlich – doch die vielen Aha-Momente der beteiligten Verkehrsverbünde, Städte und weitere Praxispartner*innen und Verwaltungen?zeigen, wie neu dieser Blick auf Zielgruppen und Evaluation oft noch ist. Deutschlandticket, Evaluation & die Frage nach Wirkung Natürlich sprechen wir auch über aktuelle Beispiele wie das Deutschlandticket. Jutta lobt die Chance, neue Routinen zu schaffen, warnt aber: „Die Unsicherheit, ob es bleibt, ist kontraproduktiv.“ Eva ergänzt, dass Evaluation in vielen Organisationen noch ein Stiefkind ist: „Lieber investiert man in Plakate als in begleitende Evaluation – aber genau die entscheidet über nachhaltige Wirkung.“ Ein Gespräch, das Mut macht Diese Folge zeigt, wie Forschung und Praxis voneinander lernen können, wie wichtig Kommunikation für die Verkehrswende ist – und dass Veränderung tatsächlich möglich ist. Eva verrät am Ende: „Ich habe während des Projekts gelernt, Fahrrad statt Auto zu fahren. Es ist möglich!“ Das Playbook steht frei zum Download bereit – und meine Gäste laden ausdrücklich dazu ein, damit zu arbeiten. Der heutige Partner für diese Folge ist m-way . Solltet ihr auch Interesse an einer Kooperation haben oder Gast in meinem Podcast sein wollen, meldet euch gern! Der Schweizer E-Bike-Experte m-way treibt bereits seit 2010 die E-Mobilität voran. In über 30 Filialen, darunter auch einem Store in Nürnberg , sowie im Online-Shop (aktuell mit großem Sale und bis zu 60 Prozent Rabatt) findet man eine große Auswahl an City-, Trekking-, Mountain- und Lasten-E-Bikes führender Marken – ergänzt durch Zubehör, ergonomische Beratung und einen Top-Werkstattservice. Ob ihr eine kostenlose Probefahrt machen, einen Termin in der Bikewerkstatt buchen oder euch individuell beraten lassen möchtet – bei m-way seid ihr in den besten Händen. Folgt ihnen auch bei Instagram und Facebook – um keine E-Bike-Highlights, Tipps und Aktionen mehr zu verpassen.Die Mobilität der Zukunft braucht nicht nur gute Produkte, sondern auch gute Kommunikation – zwischen Menschen, Städten, Anbieter*innen und der Forschung. Genau hier bringt sich m-way aktiv ein – mit Erfahrung, Haltung und dem Anspruch, Mobilität ganzheitlich zu denken. Meine Arbeit generiert dir Mehrwerte? Dann freue ich mich über deinen Support! Meinen wöchentlichen Newsletter gibt es bei steady . Es gibt es mein erstes Kinderbuch ! Und ab sofort vorbestellbar: „Picknick auf der Autobahn.“ In unserem hoffnungsfrohen Buch bieten wir konkrete und detaillierte Antworten und somit Doping für unsere Vorstellungskraft. Meinen Podcast schon abonniert? Wenn dir diese oder auch eine andere Folge gefällt, lass´ gern eine Bewertung da und/oder supporte mich per Ko-Fi oder PayPal . Anfragen an hallo@mmw-voices.de.…
s
she drives mobility
1 Beyond the Buzz: Rethinking Cars, Tech & Truth with Ed Niedermeyer 56:23
56:23  التشغيل لاحقا
التشغيل لاحقا  التشغيل لاحقا
التشغيل لاحقا  قوائم
قوائم  إعجاب
إعجاب  احب56:23
احب56:23
In my new episode of *she drives mobility*, I spoke with Ed Niedermeyer – author of the book * Ludicrous: The Unvarnished Story of Tesla Motors * and co-host of the podcast * Autonocast *. Our discussion revolved around Tesla, autonomous driving and the fundamental question: How do we want to be mobile in the future? If you like this episode, put some stars on it or send it to someone who should listen to it. I make this all pro bono, but feel free to support me per Ko-Fi oder PayPal . My weekly german newsletter can be subscribed here steady . My english blog is hosted at Medium . I work as a keynote speaker, panelist and author. Feel free to contact me! **Tesla: progress that isn’t progress at all** Ed impressively explained to me how Tesla has managed to squeeze new technologies such as the electric drive into an old, familiar product – the American car – in such a way that hardly anything changes. Long range, big battery, big car. The illusion of the future without people having to question their behavior. And that is precisely the problem. “Tesla sells us the old as something new – and people love it because they don’t have to change anything.” I also often see that we in Germany – especially in the automotive industry – still think too much in traditional patterns. Instead of seizing the opportunities for real transformation, we cling to what has gone before. And still praise Elon Musk as a visionary, even though he is blocking precisely this change. **Electric cars are not automatically climate-friendly** Ed has raised an important point: The way we talk about e-mobility is preventing the transportation transition. If range is everything, we need huge batteries. And then e-cars are only for the rich. The real potential of electromobility lies in small, lightweight vehicles for short distances. And yes – maybe even an e-bike or a scooter. “The average trip in the USA is six miles long – why do we need 300 miles of range?” I also often ask myself why we don’t manage to align mobility with real needs. Why do we still define freedom in terms of ownership – instead of shared, accessible and needs-based offers? **Autonomous driving: Wishful thinking with side effects** Another topic was Tesla’s promise of “Full Self Driving”. For years, customers have been led to believe that their cars would soon drive themselves. But the technology still doesn’t deliver. On the contrary: it brings with it new risks because drivers rely too much on the system – and react too slowly in an emergency. “Autopilot sounds like control, but in reality it makes us worse drivers.” I am convinced that autonomous driving can make sense – but not in a private car in the middle of the city center. I see much more potential in rural areas, for on-demand services or shared fleets. But this presupposes that we finally stop seeing the car as the universal solution to all mobility issues. **How technology is changing our view of mobility** What I appreciate about Ed’s work: He doesn’t oppose technology – but he demands that we finally see it for what it is: a tool. And not a promise of salvation. We have to ask ourselves: does this technology serve people – or do we serve it? “We have to learn again that technology should support us – not the other way around.” I too would like to see more urban spaces for people – not for parked cars. I dream of cities where we don’t have to take a “vacation from the car”, but where car-free living is part of everyday life. And I know that there are no easy solutions. But it starts with the question: How do we really want to live? **My conclusion: we are not too small to make a difference** I know how often people say to me: “What am I supposed to change?” Or how often people who have visions are ridiculed. But that’s exactly what drives me at *she drives mobility*: To show people that they are not alone – and that change is possible if we have the courage to think differently. “Change begins in the mind – and with the willingness to ask questions.” Thank you, Ed, for this honest, intelligent and inspiring conversation. And thank you to everyone who listened, thought and joined in the discussion. We need these voices more than ever.…
s
she drives mobility
1 Glass Walls: Breaking Down Barriers to Gender Equity at Work and Beyond - with Amy Diehl. 40:05
40:05  التشغيل لاحقا
التشغيل لاحقا  التشغيل لاحقا
التشغيل لاحقا  قوائم
قوائم  إعجاب
إعجاب  احب40:05
احب40:05
In this powerful episode of She Drives Mobility , I spoke with Dr. Amy Diehl – author, CIO, gender equity researcher, and fierce advocate for inclusive workplaces – and sister from another mister. Together, we explore the structural barriers women face across industries, especially in tech and mobility, and how Amy’s research brings invisible biases into the light. If you like this episode, put some stars on it or send it to someone who should listen to it. I make this all pro bono, but feel free to support me per Ko-Fi oder PayPal . My weekly german newsletter can be subscribed here steady . My english blog is hosted at Medium . I work as a keynote speaker, panelist and author. Feel free to contact me! Amy co-authored the book Glass Walls: Shattering the Six Gender Bias Barriers Still Holding Women Back at Work , in which she and Dr. Leanne Dzubinski define and name the subtle (and not so subtle) ways bias persists in professional environments. We dive into how exclusion, undervaluation, and male-centered design play out not just in workplaces but also in mobility systems – and how both women advocate for a future that is safer, fairer, and more inclusive for all. Episode Timeline & Highlights: Introduction & Shared Mission Katja and Amy reflect on meeting via social media and their shared values. “Sometimes I feel like I’ve met my long-lost cousin from Germany.” – Amy Gender Bias in Tech & Autonomous Systems Amy discusses how tech, especially AI and autonomous vehicles, often fails to represent or serve everyone equally due to non-diverse development teams. “We need everyone at the table – pregnant women, children, people with disabilities – so tech works for everyone.” Feminism vs. Equalism Amy explains why she now calls herself an equalist , advocating for equity across all identities – gender, race, health, ability, age. The Six Glass Walls: Structural Barriers Women Face Amy outlines the six key biases from her book with real-world examples that resonate far beyond the workplace: Male Privilege “Workplaces were made by men, for men – and that’s still true today.” Disproportionate Constraints From career paths to muted voices and “he-peating,” women’s options are still systematically narrowed. Insufficient Support “If business decisions are made on the golf course, women will never be in the room.” Devaluation Undervaluation of care work, unequal pay, and credibility deficit : “They ask the man next to you if you’re right – even when you just said it yourself.” Hostility Both from men and sometimes other women (queen bee or mean girl behavior). “When it comes from another woman, it hurts even more.” Acquiescence When women withdraw – not out of weakness, but from exhaustion: “It’s not a failure; it’s a rational choice for survival in a broken system.” New Book Preview: Excuses, Excuses Amy previews her upcoming book focused on the excuses women constantly face: too young, too old, too emotional, too ambitious… “There’s no sweet spot for women – the excuse is always that she’s a woman in the first place.” The Business Case for Inclusion Amy highlights real-world success stories, like U.S. retailer Costco , which maintained its DEI commitment despite political backlash – and saw rising profits. “Why wouldn’t we want diverse teams if we serve diverse people?” Why This Episode Matters: Brings structure and clarity to systemic gender bias Connects mobility, tech, and gender equity in an accessible way Offers practical insight, compassion, and solutions – not just critique Equally relevant for women, allies, managers, policymakers, and anyone working for change…
s
she drives mobility
1 Tödlich verharmlost – wie Sprache Verkehrsgewalt unsichtbar macht. 1:05:08
1:05:08  التشغيل لاحقا
التشغيل لاحقا  التشغيل لاحقا
التشغيل لاحقا  قوائم
قوائم  إعجاب
إعجاب  احب1:05:08
احب1:05:08
Schön, dass du reinschaltest! Meine Arbeit generiert dir Mehrwerte? Dann freue ich mich über deinen Support! Meinen wöchentlichen Newsletter gibt es bei steady . Es gibt es mein erstes Kinderbuch ! Und ab sofort vorbestellbar: „Picknick auf der Autobahn.“ In unserem hoffnungsfrohen Buch bieten wir konkrete und detaillierte Antworten und somit Doping für unsere Vorstellungskraft. Meinen Podcast schon abonniert? Wenn dir diese oder auch eine andere Folge gefällt, lass´ gern eine Bewertung da und/oder supporte mich per Ko-Fi oder PayPal . Anfragen an hallo@mmw-voices.de. In dieser Folge sprechen Felix Schindler, Andrea Sabine Sedlaczek und Dirk Schneidemesser mit mir über sprachliche Verharmlosung, Verantwortung und den Sprachkompass. Jeden Tag sterben acht Menschen im Straßenverkehr. Und doch liest man in der Zeitung meistens: „LKW übersieht Radfahrerin.“ Als wäre es ein Schicksalsschlag. Es ist so, als hätte niemand gehandelt. Es scheint so, als würde sich niemand verantwortlich fühlen. In dieser Folge von She Drives Mobility spreche ich mit einem ganz besonderen Team hinter dem Projekt Sprachkompass . Das ist ein interdisziplinärer Forschungsprojekts, das zeigt, wie Sprache unser Denken, unsere Stadtplanung und letztlich unser (Nicht-)Handeln beeinflusst. Wer spricht – und warum das wichtig ist: Felix Schindler, ein Journalist aus der Schweiz, hat sich mal die Routinen der Medien vorgenommen. „Ich habe selbst jahrelang solche Kurzmeldungen redigiert – ohne zu hinterfragen, wie entmenschlichend die Formulierungen sind. Erst als Vater habe ich gespürt: Diese Sprache macht etwas mit unserer Wahrnehmung von Sicherheit.“ „Wenn ein LKW plötzlich ‚übersieht‘, wird Verantwortung sprachlich ausradiert.“ „Solche Formulierungen wie ‚wurde erfasst‘ klingen technisch, aber sie entlasten – und das unbewusst. „ Andrea Sabine Sedlaczek, Sprachwissenschaftlerin aus Wien, zeigt, wie Worte unser Weltbild prägen: „Wenn wir von „Unfällen“ oder „übersehenen Personen“ sprechen, machen wir Täter zu Opfern und die Opfer zu bloßen Randnotizen. Sprache reproduziert Gewalt, oft ungewollt.“ „Sprache ist kein neutrales Werkzeug – sie ist ein Verstärker von Machtverhältnissen.“ „Wer passiv formuliert, schützt Strukturen – nicht Menschen.“ „Wenn Medien von ‚Verkehrsteilnehmenden‘ sprechen, verwischt das, wer gefährdet – und wer gefährlich ist.“ Dirk Schneidemesser, Mobilitätsforscher vom RIFS Potsdam, bringt es auf den Punkt: „Ein Auto kann niemanden ‚erfassen‘. Das machen Menschen. Aber wenn wir solche Formulierungen ständig lesen, verschwinden Verantwortung und Strukturprobleme aus dem Fokus.“ „Verkehr ist kein Naturereignis – und Gewalt auf der Straße ist keine unvermeidbare Folge.“ „Der Sprachkompass zeigt: Wer klar benennt, kann auch klar verändern.“ „Sprache entscheidet mit, ob wir ein Opfer betrauern – oder Ursachen beseitigen.“ In dieser Folge lernst du Folgendes: Sprache ist nie neutral. Sie beeinflusst, wie wir Schuld, Verantwortung und Systemfehler einordnen. Oft stehen in Texten Opfer im Fokus, während die Täter verschleiert werden. Das liegt daran, dass die Polizei- und Medienlogik so funktioniert. Es werden vor allem passive Formulierungen verwendet: „Radfahrerin geriet unter LKW“, „Kind wurde erfasst“ – der Mensch hinter dem Lenkrad bleibt unsichtbar. Die Zahlen sprechen für sich: In 69 % der Texte, die untersucht wurden, wurden passive Formulierungen verwendet. In 95 % der Fälle fehlt jede statistische Kontextualisierung. Die Sprache ist fünfmal öfter entlastend für Autofahrer:innen als für Fußgänger:innen oder Radfahrer:innen. Es geht nicht darum, irgendjemandem die Schuld zu geben, sondern darum, die Dinge richtig zu beschreiben – also die Ursachen, die Beteiligten und den Kontext. Der Sprachkompass zeigt: Wenn sich die Sprache ändert, kann sich auch das System ändern. Der Leitfaden richtet sich insbesondere an Polizei und Medien. Er soll aber auch dazu beitragen, die Verantwortung aller für die Verkehrssicherheit sprachlich sichtbar zu machen. Dazu gibt er fünf Empfehlungen: Unfälle nicht als Schicksal, sondern als menschengemacht darstellen. Beispiel: „A und B kollidierten“ statt „Es kam zum Unfall.“ Alle beteiligten Personen und deren Handlungen benennen. Beispiel: „Fußgängerin von Velofahrer angefahren“ statt „Fußgängerin angefahren“. Die Perspektiven der Beteiligten klar kennzeichnen. Beispiel: „Der Autofahrer erklärte, er habe die Fußgängerin übersehen.“ statt „Der Autofahrer übersah die Fußgängerin.“ Den Ermittlungsstand transparent machen. Beispiel: „Wie schnell die Autofahrerin unterwegs war, ist nicht bekannt.“ statt „Die Hintergründe des Unfalls sind Gegenstand der Ermittlungen.“ Einzelereignisse in einen größeren Zusammenhang stellen. Beispiel: „Das ist die vierte Kollision auf dieser Kreuzung in diesem Jahr.“ Warum du diese Folge hören solltest: Weil sie dir zeigt, wie Gewalt systematisch unsichtbar gemacht wird – und wie wir durch bewusste Sprache echte Veränderung anstoßen können. Denn: Was wir nicht benennen, das können wir nicht bekämpfen. Mehr zur Studie & Materialien für Medien und Polizei: sprachkompass.ch Keine Folge mehr verpassen? steadyhq.com/de/shedrivesmobility Teile diese Folge mit Journalist:innen, Politiker:innen, Planer:innen und allen, die glauben, Sprache sei „nur ein Stilmittel“. Sie ist unser mächtigstes Werkzeug.…
s
she drives mobility
1 Politik mit Haltung: Winfried Hermann, dienstältester Verkehrsminister Deutschlands, im Rück- und Ausblick. 46:31
46:31  التشغيل لاحقا
التشغيل لاحقا  التشغيل لاحقا
التشغيل لاحقا  قوائم
قوائم  إعجاب
إعجاب  احب46:31
احب46:31
Schön, dass du reinschaltest! Meine Arbeit generiert dir Mehrwerte? Dann freue ich mich über deinen Support! Meinen wöchentlichen Newsletter gibt es bei steady . Ab sofort lohnt sich ein Newsletter noch mehr, weil ich alle 14 Tage Videopodcasts meiner Interviewpartner*innen aus „Raus aus der AUTOkratie – rein in die Mobilität von morgen!“ exklusiv für meine Abonnent*innen zur Verfügung stelle. Seit dem 27. Mai gibt es mein erstes Kinderbuch ! Und ab sofort vorbestellbar: „Picknick auf der Autobahn.“ In unserem hoffnungsfrohen Buch bieten wir konkrete und detaillierte Antworten und somit Doping für unsere Vorstellungskraft.Meinen Podcast schon abonniert? Wenn dir diese oder auch eine andere Folge gefällt, lass´ gern eine Bewertung da und/oder supporte mich per Ko-Fi oder PayPal . Anfragen an backoffice@katja-diehl.de. Heute zu Gast: Winfried Hermann , dienstältester Verkehrsminister Deutschlands, spricht mit mir über seine politische Motivation, die Herausforderungen einer autozentrierten Gesellschaft und seinen strategischen Ansatz zur sozial-ökologischen Verkehrswende in Baden-Württemberg. Ein Gespräch über nachhaltige Mobilität, politische Resilienz und die Rolle der Zivilgesellschaft Ein politischer Lebensweg mit klarer Haltung Winfried Hermann beschreibt seinen Weg in die Politik als Reaktion auf Umweltzerstörung in den 1970er-Jahren. Er plädiert für einen werteorientierten Politikstil – gerade in einer Zeit, in der Vertrauen in politische Institutionen unter Druck steht. Es war nicht Karriereambition, sondern die Sorge um Natur, Lebensqualität und demokratische Beteiligung, die ihn motivierte: Verkehrswende im Herzen der Automobilindustrie Dass ausgerechnet in einem Bundesland wie Baden-Württemberg die verkehrspolitischen Weichen neu gestellt wurden, gilt in der Bundesrepublik als Signal: Es geht – wenn der politische Wille da ist. Hermann berichtet von anfänglichem Spott und Widerstand, aber auch von einem gewandelten Bewusstsein in Bevölkerung und Wirtschaft: Was nachhaltige Mobilität wirklich bedeutet Der Begriff ist oft schwammig – Hermann verleiht ihm Substanz: Nachhaltige Mobilität bedeutet für ihn, dass Verkehr ökologisch tragfähig, sozial gerecht und ökonomisch effizient gestaltet wird. Der ÖPNV, Rad- und Fußverkehr spielen dabei eine zentrale Rolle – nicht nur ökologisch, sondern auch als Voraussetzung für Teilhabe. Transformation mit Strategie und Realismus Hermann betont immer wieder die Notwendigkeit strategischer Zielsysteme und wissenschaftlicher Fundierung. Er beschreibt konkrete Fortschritte im Land – von Echtzeitdaten über eine stärkere Verzahnung von Verkehrsträgern bis hin zu modernen Schienenfahrzeugen. Zugleich warnt er vor Rückschritten und Verzögerungen: Kritik an politischer Mutlosigkeit und wirtschaftlicher Zögerlichkeit Besonders scharf kritisiert Hermann die Rolle von Teilen der Bundespolitik beim Thema E-Mobilität. Die „Technologieoffenheit“ sei oft ein Vorwand, um überfällige Entscheidungen zu vermeiden: Er fordert ein entschlosseneres Zusammenspiel von Politik, Wirtschaft und Zivilgesellschaft. Zukunftsbilder für Stadt und Land: kollektive Mobilität neu denken Mit Blick auf ländliche Räume und Randlagen spricht Hermann über das Potenzial autonomer, gemeinschaftlich genutzter Fahrzeuge. Gerade hier liege der Schlüssel zur Verbindung von Klimaschutz, Daseinsvorsorge und Lebensqualität: Appell: Die Verkehrswende braucht viele Schultern Zum Schluss richtet Hermann einen Appell an Bürger*innen, Verwaltungen und Politik: Verkehrswende sei kein Top-down-Projekt, sondern ein gemeinsames Gestaltungsfeld. „Demokratie lebt vom Mitmachen. Es reicht nicht, gute Ideen zu fordern – man muss sie auch mittragen.“ Dieses Gespräch ist ist nicht nur eine Bestandsaufnahme – es ist ein Plädoyer für Haltung in der Politik, für langfristiges Denken und für echte Beteiligung. Wer sich mit nachhaltiger Mobilität, Infrastrukturpolitik oder Change-Management beschäftigt, findet hier nicht nur fachliche Impulse, sondern auch Mut zur Veränderung.…
s
she drives mobility
1 Sharing is Caring: Wie wir Mobilität gerechter machen - von Stadt bis Land. 51:47
51:47  التشغيل لاحقا
التشغيل لاحقا  التشغيل لاحقا
التشغيل لاحقا  قوائم
قوائم  إعجاب
إعجاب  احب51:47
احب51:47
Diese Folge entstand in Kooperation mit VOI. Wenn auch du ein Unternehmen, eine Idee zur Mobilitätswende hast, melde dich gern! backoffice@katja-diehl.de – ich freue mich, wenn wir kooperieren! Schon abonniert? Seit sechs Jahren veröffentliche ich alle 14 Tage eine neue Episode von She Drives Mobility. Mein Podcast widmet sich der gerechten, inklusiven und zukunftspositiven Verkehrswende. Ich spreche mit Menschen aus Politik, Wirtschaft, Wissenschaft und Zivilgesellschaft – offen, kritisch und lösungsorientiert. Im Mittelpunkt: Wie wir Mobilität neu denken können – sozial, feministisch und fossilfrei. Heute gibt es wieder eine neue Folge – mit Martin Richard Becker von Voi Technology und Stefan Carsten , der als Zukunfts- und Mobilitätsforscher im Gespräch die „Generation Scooter“ ausgerufen hat. Also schnell abonnieren und keinen Impuls mehr verpassen. Sonntag gehts um urbane Potenziale und ländliche Herausforderungen. Um neue Generationen ohne Besitzansprüche und Unabhängigkeit durch Lässigkeit. Thematische Gliederung der Folge: Mikromobilität im Wandel Von der „letzten Meile“ zur vollwertigen Mobilitätslösung Infrastrukturbedarfe für E-Scooter, Fahrräder und Co. Datenbasierte Erkenntnisse über Nutzungsmuster Verkehrswende in Stadt & Land – Gemeinsamkeiten und Unterschiede Warum Verkehrspolitik oft an urbanen Realitäten ausgerichtet ist Herausforderungen im ländlichen Raum: Entfernungen, Infrastruktur, soziale Isolation Lokale Lösungsansätze wie On-Demand-Angebote, Sharing im Dorf Sharing Economy: Modeerscheinung oder Gamechanger? Die Rolle geteilter Mobilitätsformen im Wandel Was funktioniert bereits – und was (noch) nicht? Vertrauen, Regulierung und Raumverteilung Mobilität als soziale Frage Wer wird wie mobil – und wer bleibt zurück? Kosten, Barrieren und gerechte Verteilung von Mobilitätsangeboten Warum Mobilität mehr als Fortbewegung ist: Teilhabe, Arbeit, Wohnen Kultureller Wandel statt nur Technikwechsel Warum Technologie allein keine Wende bringt Die Rolle von Gewohnheiten, Symbolik und gesellschaftlichen Leitbildern Neue Narrative für eine geteilte, nachhaltige Zukunft Ausblick & Handlungsimpulse Was wünschen sich die Gäste von der Politik? Was können Kommunen, Unternehmen und Zivilgesellschaft konkret tun? Mut, Pragmatismus und Allianzen als Schlüssel zur Transformation Martin Becker : „Wir müssen raus aus dem Denken: Auto oder nichts. Es braucht einen dritten Weg – und der kann geteilt sein. „ Dr. Stefan Carsten: „Die Verkehrswende ist kein technisches Projekt – sie ist ein kultureller Wandel.“…
s
she drives mobility
1 Rebellion gegen Repression – Für Klimaschutz, Gerechtigkeit & Grundrechte. 1:01:15
1:01:15  التشغيل لاحقا
التشغيل لاحقا  التشغيل لاحقا
التشغيل لاحقا  قوائم
قوائم  إعجاب
إعجاب  احب1:01:15
احب1:01:15
Schön, dass du reinschaltest! Meine Arbeit generiert dir Mehrwerte? Dann freue ich mich über deinen Support! Meinen wöchentlichen Newsletter gibt es bei steady . Ab sofort lohnt sich ein Newsletter noch mehr, weil ich alle 14 Tage Videopodcasts meiner Interviewpartner*innen aus „Raus aus der AUTOkratie – rein in die Mobilität von morgen!“ exklusiv für meine Abonnent*innen zur Verfügung stelle. Seit dem 27. Mai gibt es mein erstes Kinderbuch ! Und ab sofort vorbestellbar: „Picknick auf der Autobahn.“ In unserem hoffnungsfrohen Buch bieten wir konkrete und detaillierte Antworten und somit Doping für unsere Vorstellungskraft.Meinen Podcast schon abonniert? Wenn dir diese oder auch eine andere Folge gefällt, lass´ gern eine Bewertung da und/oder supporte mich per Ko-Fi oder PayPal . Anfragen an backoffice@katja-diehl.de. In dieser auch für mich aufrüttelnden Folge von She Drives Mobility spreche ich mit Carla Hinrichs, Lisa Pöttinger und David Werdermann über den schmalen Grat zwischen Protest und Kriminalisierung. Carla, ehemals Pressesprecherin der letzten Generation, steht vor dem Vorwurf der Gründung einer kriminellen Vereinigung. Lisa kämpft in Bayern um ihre berufliche Existenz, weil ihr Klimaengagement als „charakterlich ungeeignet“ für den Lehrerberuf gilt. Hier könnt ihr sie unterstützen. Und David von der Gesellschaft für Freiheitsrechte ordnet die juristischen Hintergründe ein. Was bedeutet das für uns alle? Wo endet demokratischer Protest – und wo beginnt staatliche Repression? Diese Folge ist ein Weckruf an alle, die für eine gerechte, lebenswerte Zukunft einstehen. Carla Hinrichs – ehemals Pressesprecherin der „Letzten Generation“ – erzählt eindringlich, wie sie gemeinsam mit anderen Klimaaktivist innen wegen des Vorwurfs der „Gründung einer kriminellen Vereinigung“ ins Visier der Behörden geraten ist. Dabei schildert sie nicht nur die absurden Details der Ermittlungen, sondern auch, wie die staatliche Härte und Repression tief in ihr Leben und das ihrer Mitstreiter innen eingegriffen hat. Lisa Pöttinger, Klimaaktivistin aus München, berichtet, wie ihr Engagement für Klimagerechtigkeit und ihre Zugehörigkeit zu linken Bewegungen ihr die Tür zum Lehrerberuf verschlossen hat – unter dem Vorwand der „charakterlichen Nichteignung“. Ihre Geschichte ist nicht nur ein persönliches Drama, sondern auch ein Beispiel für die Einschüchterung und politische Ausgrenzung, die in unserer Gesellschaft zunehmend Platz greift. David Werdermann von der Gesellschaft für Freiheitsrechte (GFF) ordnet diese Fälle juristisch ein und erklärt, wie solche Angriffe auf Grundrechte wie Meinungs- und Versammlungsfreiheit nicht nur einzelne Menschen treffen, sondern das Fundament unserer Demokratie erschüttern. Carla Hinrichs: 1️⃣ „Was wir gerade erleben, ist ein Zurückdrehen von Rechten, die wir uns mühsam erkämpft haben – und das ist einfach beängstigend.“ 2️⃣ „Ich will mich nicht in 20 Jahren fragen, was ich damals gemacht habe, als ich es noch konnte.“ Lisa Pöttinger: 1️⃣ „Dass mein Engagement als antidemokratisch eingestuft wird, weil ich System Change und Climate Justice fordere, ist absurd – und brandgefährlich.“ 2️⃣ „Repression will uns vereinzeln, aber wir müssen jetzt erst recht zusammenhalten.“ David Werdermann: 1️⃣ „Der Staat sollte Grundrechte schützen, nicht einschränken – und erst recht nicht pauschal kriminalisieren.“ 2️⃣ „Kriminelle Vereinigung war nie für friedlichen Protest gedacht – aber genau dafür wird der Paragraph jetzt missbraucht.“ Diese Episode zeigt, wie gefährlich es ist, wenn das Engagement für eine bessere Welt kriminalisiert und mit staatlicher Härte bekämpft wird – und warum es gerade jetzt wichtig ist, laut zu werden, sich zu solidarisieren und die Demokratie aktiv zu verteidigen. 🎧 Hör rein, wenn du wissen willst: Wie Klimaschutz zur Staatsaffäre wird. Warum Solidarität das stärkste Mittel gegen Repression ist. Was wir alle tun können, um unsere Grundrechte zu verteidigen. Diese Folge ist nicht nur ein Aufruf zum Mitdenken, sondern auch ein Mutmacher für alle, die für eine gerechtere, lebenswertere Zukunft kämpfen.…
s
she drives mobility
1 „Anschub für morgen“ – Mobilität zwischen Regierung und Rampe 49:30
49:30  التشغيل لاحقا
التشغيل لاحقا  التشغيل لاحقا
التشغيل لاحقا  قوائم
قوائم  إعجاب
إعجاب  احب49:30
احب49:30
Schön, dass du reinschaltest! Meine Arbeit generiert dir Mehrwerte? Dann freue ich mich über weiteren Support! Meinen wöchentlichen Newsletter gibt es bei steady . Ab sofort lohnt sich ein Newsletter noch mehr, weil ich alle 14 Tage Videopodcasts meiner Interviewpartner*innen aus „Raus aus der AUTOkratie – rein in die Mobilität von morgen!“ exklusiv für meine Abonnent*innen zur Verfügung stelle. Am 27. Mai kommt mein erstes Kinderbuch – bestell´ es gern schon vor! Und ab sofort auch vorbestellbar: „Picknick auf der Autobahn.“ In unserem hoffnungsfrohen Buch bieten wir konkrete und detaillierte Antworten und somit Doping für unsere Vorstellungskraft.Meinen Podcast schon abonniert? Wenn dir diese oder auch eine andere Folge gefällt, lass´ gern eine Bewertung da und/oder supporte mich per Ko-Fi oder PayPal . Anfragen an backoffice@katja-diehl.de. Leonore Gewessler und Hubert Schlager über die Elektrifizierung der Logistik In dieser Episode treffen Politik und Praxis auf Augenhöhe: Die ehemalige österreichische Klimaschutzministerin Leonore Gewessler und der oberösterreichische Unternehmer Huber Schlager sprechen über ihren gemeinsamen Weg in Richtung klimafreundliche Mobilität – aus zwei sehr unterschiedlichen Perspektiven, aber mit derselben Überzeugung: Die Zukunft des Verkehrs ist elektrisch – wenn wir sie richtig gestalten. Schwerpunkte von Leonore Gewessler: Warum Technologieoffenheit nicht Stillstand heißen darf Wie man Klimaziele rückwärts denkt: Vom Jahr 2040 zurück in konkrete Maßnahmen heute Förderpolitik als Mittel zur Transformation – nicht als „Bonus“, sondern als Einstiegshilfe Warum systemisches Denken in der Politik so schwer, aber so notwendig ist Der Appell an Mut, strategisches Lernen und ressortübergreifendes Handeln Leonore Gewessler macht deutlich: Klimapolitik darf sich nicht in Ankündigungen verlieren. Sie schildert aus ihrer Zeit im Ministerium, wie wichtig es ist, über Silogrenzen hinwegzudenken und gemeinsam mit Wirtschaft, Verwaltung und Wissenschaft förderpolitische Instrumente zu schaffen, die neue Märkte öffnen statt alte Strukturen zu verwalten. Schwerpunkte von Huber Schlager: Praxistest E-LKW: Warum sein Unternehmen jetzt schon 620.000 km elektrisch gefahren ist Herausforderungen beim Stromnetz, bei Ladeinfrastruktur und im Alltag mit Fahrer:innen Warum Wasserstoff in seiner Praxis keine Zukunft hat Wie Förderung Türen öffnet – und wie wichtig eine langfristige Planung ist Die Rolle seiner Tochter in der Betriebsnachfolge – und warum Transformation auch Familienangelegenheit ist Hubert Schlager berichtet anschaulich und ehrlich aus dem betrieblichen Alltag: von anfänglichen Unsicherheiten bis hin zur Begeisterung vieler Fahrer:innen. Er zeigt, wie Elektromobilität wirtschaftlich, technisch und kulturell funktionieren kann – wenn Politik und Wirtschaft gut zusammenspielen. Gemeinsame Botschaften: Es braucht politische Mutmacher:innen und unternehmerische Möglichmacher:innen Klimaschutz beginnt mit klaren Rahmenbedingungen – und dem Mut, neue Wege zu gehen Planungssicherheit, Systemdenken und Zusammenarbeit sind der Schlüssel zum Erfolg Diese Folge ist ein ermutigendes Beispiel dafür, wie Wandel konkret aussehen kann – mit allen Herausforderungen, aber auch mit ganz viel Tatkraft und Hoffnung. Leonore Gewessler – Zitate „Die Zukunft auf der Straße ist elektrisch – und ja, das funktioniert.“ „Wenn wir sagen, Österreich wird 2040 klimaneutral, dann müssen wir heute ganz konkret zurückrechnen, was das bedeutet.“ „Wir dürfen nicht einfach Technologien austauschen, wir müssen das System anders denken.“ „Förderungen machen eine erste Hürde kleiner – sie bringen Bewegung, wo vorher Stillstand war.“ „Verkehr vermeiden, verlagern, verbessern – das ist die Logik, nach der wir handeln müssen.“ Huber Schlager – Zitate „Wir haben in 14 Monaten über 620.000 Kilometer elektrisch zurückgelegt – mit 100 % Ökostrom.“ „Ich bin überzeugt: Batteriebetrieb ist die Zukunft. Wasserstoff hat sich bei uns nicht bewährt.“ „Man muss es systemisch denken – Fahrzeug, Stromanschluss, Energieerzeugung, alles zusammen.“ „Unsere Fahrer waren anfangs skeptisch. Heute streiten sie sich darum, wer elektrisch fahren darf.“ „Ich sage immer: Fangt jetzt an! In zehn Jahren ist das Standard. Wer heute nicht plant, bleibt zurück.“ Eine Folge über unternehmerischen Mut, politischen Gestaltungswillen – und darüber, wie konkrete Veränderung möglich wird.…
s
she drives mobility
1 Müssen Frauen den Raum verlassen? Gespräche über Männlichkeit(en), Privilegien & Gleichstellung 1:47:25
1:47:25  التشغيل لاحقا
التشغيل لاحقا  التشغيل لاحقا
التشغيل لاحقا  قوائم
قوائم  إعجاب
إعجاب  احب1:47:25
احب1:47:25
Schön, dass du reinschaltest! Meine Arbeit generiert dir Mehrwerte? Dann freue ich mich über weiteren Support! Meinen wöchentlichen Newsletter gibt es bei steady . Ab sofort lohnt sich ein Newsletter noch mehr, weil ich alle 14 Tage Videopodcasts meiner Interviewpartner*innen aus „Raus aus der AUTOkratie – rein in die Mobilität von morgen!“ exklusiv für meine Abonnent*innen zur Verfügung stelle. Meine kleine She Drives Mobility Academy soll Wissen und Mut vervielfältigen und für Vernetzung sorgen. Vor allem das Paket für 24 Euro im Monat für fünf Personen könnte also etwas für euch als Freund*innnen oder Kolleg*innen sein, um gemeinsam sich inspirieren zu lassen! Am 27. Mai kommt mein erstes Kinderbuch – bestell´ es gern schon vor! Und ab sofort auch vorbestellbar: „Picknick auf der Autobahn.“ In unserem hoffnungsfrohen Buch bieten wir konkrete und detaillierte Antworten und somit Doping für unsere Vorstellungskraft.Meinen Podcast schon abonniert? Wenn dir diese oder auch eine andere Folge gefällt, lass´ gern eine Bewertung da und/oder supporte mich per Ko-Fi oder PayPal . Anfragen an backoffice@katja-diehl.de. Gespräch mit Daniel Pauw über Männlichkeit, Privilegien & gesellschaftlichen Wandel Über den Gast: Daniel Pauw ist systemischer Berater, Coach und Mitautor des Buchs New Work Man . Mit über 15 Jahren Erfahrung in Organisationsentwicklung und Transformationsprozessen arbeitet er heute bei Covolution. Außerdem ist er Gründer von Salty Elephant (Yoga-Reisen) und lebt in München. Zentrale Themen: Traditionelle Männlichkeit & ihre Folgen: Männliche Rollenbilder prägen Selbst- und Fremdbild nachhaltig. Sie fördern emotionale Abgrenzung, Selbstüberforderung und wirken sich negativ auf Gesundheit, Sozialkompetenz und Umweltverhalten aus. Männer sterben im Schnitt fünf Jahre früher – nicht biologisch bedingt, sondern durch sozialisierte Lebensführung. Genderstereotype & strukturelle Ungleichheiten: Frauen – auch High Potentials – erhalten überproportional mehr negatives Feedback. Tief verankerte Geschlechterrollen benachteiligen nicht nur Frauen und FLINTA-Personen, sondern auch Männer selbst. Sichtbare Symptome reichen von ungleicher Besteuerung (z. B. Hygieneprodukte) bis zu Alltagsdiskriminierung. Kontakt & Bildung als Schlüssel: Der beste Weg, Vorurteile abzubauen, ist echter Dialog und Kontakt mit Menschen außerhalb der eigenen sozialen Blase. Bildung über Gender, Intersektionalität und strukturelle Ungleichheit ist in Deutschland stark unterrepräsentiert und sollte integraler Bestandteil gesellschaftlicher Diskurse sein. Anschlussfähigkeit statt Abwehr: Feministische Narrative stoßen bei vielen Männern auf Abwehr, weil sie sich nicht angesprochen fühlen. New Work Man zielt darauf ab, Männer dort abzuholen, wo sie stehen – über ihre Arbeit – und eine Brücke zur Selbstreflexion zu schlagen. Emotionale Räume für Männer: Männer brauchen sichere soziale Räume, um Zugang zu Gefühlen und Verletzlichkeit zu bekommen. Scham und das Bedürfnis, „okay“ zu sein, prägen viele männliche Lebensmuster. Diese aufzubrechen kann persönliche Heilung und gesellschaftlichen Wandel anstoßen. Starten statt Warten: Veränderung beginnt mit kleinen Schritten – z. B. Gespräche mit Partnerinnen, Freund*innen oder das Aufsuchen eines Therapie- oder Reflexionsraums. Bewusstsein schafft Wandel. Zitate von Daniel Pauw „Traditionelle männliche Gender-Stereotype schaden uns. Wir leben fünf Jahre kürzer – nicht weil wir biologisch anders sind, sondern wegen unserer Lebensführung.“ „Das wirksamste Prinzip traditioneller Männlichkeit ist die Abkapselung von der eigenen Emotionalität.“ „Der feministische Diskurs ist oft nicht anschlussfähig für Männer – obwohl er auch für Männer da ist.“ „Wir brauchen Räume im Inneren der Männer – soziale Orte, in denen psychologische Sicherheit entsteht.“ „Was am meisten Vorurteile abbaut, ist echter Kontakt. Keine Theorie ersetzt ein ehrliches Gespräch.“ „Männer brauchen keine neuen Privilegien – sie brauchen Zugang zu ihrem Inneren.“ „Viele Männer merken nicht, wie sehr sie von ihren eigenen Mustern abgeschnitten sind.“ „Wir haben dieses Buch geschrieben für all die Gefühle, die nicht gefühlt wurden – und durch Wut oder Abgrenzung ersetzt wurden.“ ————————————– Gespräch mit Vincent Herr über Männlichkeit, Privilegien & Gleichstellung Über den Gast: Worüber sprechen wir? 1. Der Safe-Space-Effekt: Wenn Frauen einen Raum verlassen, ändert sich der Ton: Männer äußern sich offener, oft abwehrend oder kritisch gegenüber Gleichstellung. Das Buch dokumentiert diese Dynamiken als ehrlichen Spiegel männlicher Innenräume. 2. Wissens- und Perspektivdefizite bei Männern: Viele Männer haben kaum Bewusstsein für strukturellen Sexismus und unterschätzen Alltagsdiskriminierung. Das größte Hindernis für Fortschritt: Ignoranz, nicht aktive Ablehnung. 3. Privilegien erkennen & nutzen: Herr und Speer reflektieren kritisch, dass ihnen als weißen Männern mehr Gehör geschenkt wird – obwohl sie über Probleme sprechen, die sie selbst nicht erleben. Ihr Buch soll daher vor allem anderen Männern helfen, sich zu reflektieren und aktiv zu werden. 4. Male Allyship als Chance zur Selbstentwicklung: Verbündeter zu sein heißt: zuhören, Fehler zulassen, aktiv Sorgearbeit übernehmen, Räume öffnen – und auch eigene Routinen hinterfragen. Es geht nicht um Perfektion, sondern um echtes Interesse und Entwicklung. 5. Transformation durch Menschlichkeit: Empathie, persönliche Verbindung zum Thema und authentische Gespräche führen zu Bewusstseinswandel. Herr sieht in echter Verbundenheit und ehrlichem Austausch einen Weg zu gesellschaftlicher Veränderung. „Wenn die letzte Frau den Raum verlässt, wird der wahre Ton hörbar – und der ist oft viel kritischer gegenüber Gleichstellung.“ „Männer müssen verstehen: Sexismus ist kein Einzelfall, sondern ein System – und fast jede Frau erlebt ihn.“ „Male Allyship ist kein Zustand, sondern ein täglicher Prozess. Es geht nicht um Perfektion, sondern um Haltung.“ „Die eigentliche Arbeit beginnt nicht mit dem Buch – sie beginnt im Alltag, im Gespräch, im Zuhören.“ „Wir sprechen über Probleme, die wir als Männer nicht erleben – und genau deshalb müssen wir zuhören.“ „Männer verlieren nichts durch Gleichstellung – sie gewinnen Beziehung, Nähe, Präsenz und Sinn.“ „Sorgearbeit ist keine Frauenaufgabe, bei der Männer ‚helfen‘ – sie ist zur Hälfte Männersache.“ „Männliches Privileg zeigt sich auch darin, dass uns für dieselben Aussagen mehr Applaus gegeben wird als Frauen.“ „Wir brauchen nicht noch mehr Umfragen, wie wichtig Gleichstellung ist – wir brauchen endlich echtes Tun.“ „Echte Veränderung heißt: Nicht das System Frauen-fit machen – sondern das System verändern.“…
s
she drives mobility
1 Patriarchat am Steuer – Warum die Verkehrswende feministisch sein muss. 57:28
57:28  التشغيل لاحقا
التشغيل لاحقا  التشغيل لاحقا
التشغيل لاحقا  قوائم
قوائم  إعجاب
إعجاب  احب57:28
احب57:28
Schön, dass du reinschaltest! Meine Arbeit generiert dir Mehrwerte? Dann freue ich mich über weiteren Support! Meinen wöchentlichen Newsletter gibt es bei steady . Ab sofort lohnt sich ein Newsletter noch mehr, weil ich alle 14 Tage Videopodcasts meiner Interviewpartner*innen aus „Raus aus der AUTOkratie – rein in die Mobilität von morgen!“ exklusiv für meine Abonnent*innen zur Verfügung stelle. Meine kleine She Drives Mobility Academy soll Wissen und Mut vervielfältigen und für Vernetzung sorgen. Vor allem das Paket für 24 Euro im Monat für fünf Personen könnte also etwas für euch als Freund*innnen oder Kolleg*innen sein, um gemeinsam sich inspirieren zu lassen! Im Mai kommt mein erstes Kinderbuch – bestell´ es gern schon vor! Und ab sofort auch vorbestellbar: „Picknick auf der Autobahn.“ In unserem hoffnungsfrohen Buch bieten wir konkrete und detaillierte Antworten und somit Doping für unsere Vorstellungskraft.Meinen Podcast schon abonniert? Wenn dir diese oder auch eine andere Folge gefällt, lass´ gern eine Bewertung da und/oder supporte mich per Ko-Fi oder PayPal . Anfragen an backoffice@katja-diehl.de. Chronologische Abfolge: 00:00 – Begrüßung & Vorstellung 03:00 – Warum Boris von Heesen sein Buch „Mann am Steuer“ schrieb 08:00 – Die Machtstrukturen im Mobilitätsbereich: Männerquote 80–100 % 14:00 – Maren Urner erklärt, warum Fakten allein nicht reichen 20:00 – Autonormativität und das „Jaaaaber“-Phänomen 27:00 – Verkehr und Geschlecht: Statistiken, Ungleichheiten, Schäden 34:00 – Emotionale Verdrängung und toxische Selbstbilder 42:00 – Wie sich Vision Zero anfühlt – und warum wir es trotzdem brauchen 50:00 – Warum die feministische Verkehrswende alle befreit 57:00 – Das Labor: Boris’ konkrete Lösungsvorschläge für gerechte Mobilität 65:00 – Herz & Hirn verbinden: Wie wir Geschichten verändern können Zu Gast sind bei mir heute Autor und Wirtschaftswissenschaftler Boris von Heesen und Neurowissenschaftlerin und Professorin Maren Urner . Wir sprechen über das Patriarchat im Straßenverkehr, emotionale Abwehrmechanismen und echte Chancen für Wandel. Den Weg hin zu einer gerechteren, inklusiveren Mobilität, die auf Fakten, Gefühl und Fairness basiert. 📘 Boris von Heesen: „Das Auto ist die Fortschreibung toxischer Männlichkeit auf vier Rädern.“ 🧠 Maren Urner: „Wir verteidigen unser zerstörerisches Verhalten mit einer Inbrunst, als hinge unser Leben daran – und genau das tut es auch.“ Warum ist unser aktuelles Verkehrssystem nicht nur ungerecht, sondern auch patriarchal geprägt – und was heißt das für die Mobilitätswende? Wir sprechen über: die männlich dominierten Machtstrukturen in Verkehrsplanung, Politik und Industrie, warum es gefährlich ist, wenn Mobilität auf Geschwindigkeit, Kontrolle und Dominanz ausgerichtet ist, wie „toxische Männlichkeit“ im Straßenverkehr nicht nur andere, sondern auch Männer selbst gefährdet, wie wir als Gesellschaft emotionale Abwehrmechanismen überwinden können und weshalb es höchste Zeit ist, Verkehr nicht mehr als Technik-, sondern als Gesellschaftsfrage zu begreifen. Dabei verbinden wir Fakten mit persönlichem Erleben, wissenschaftlicher Reflexion mit politischer Klarheit. Was passiert, wenn man einen Neurowissenschaftlerin, einen Wirtschaftsexperten und eine Mobilitätsaktivistin an einen Tisch bringt? Richtig: Es wird politisch, tiefgründig, unbequem – und richtig wichtig. Wir stellen unbequeme Fragen: Warum ist unser Verkehrssystem von Macht, Dominanz und „Stärke zeigen“ geprägt? Was hat das Auto mit Männlichkeitsbildern zu tun – und was macht das mit uns allen? Wie wirken sich emotionale Abwehrmechanismen („Jaaaaber…“) auf gesellschaftlichen Wandel aus? Und warum ist die Mobilitätswende kein Technikprojekt, sondern ein kultureller Umbau? Dazu liefert Boris Zahlen und Strukturen , die sichtbar machen, was viele ahnen: Wer plant, entscheidet, investiert – ist oft männlich geprägt, von Machtlogik durchdrungen und hat selten diejenigen im Blick, die mobilitätsbenachteiligt sind: Kinder, Alte, Frauen, Menschen mit Behinderungen. Maren bringt die neuropsychologische Perspektive ein: Wie schützt sich das Gehirn gegen Veränderung? Warum klammern wir uns an zerstörerische Routinen – obwohl wir es besser wissen? Und wie können wir Kommunikation so gestalten, dass sie nicht lähmt, sondern bewegt? Ich selbst erzähle von den Realitäten auf der Straße, in der Politik, in Medien – und warum Verkehr nie „neutral“ , sondern immer gesellschaftlich hoch aufgeladen ist. Diese Folge mehr ist als ein Gespräch über Verkehr: Es ist ein Gespräch über unsere Gesellschaft, unsere inneren Widerstände – und die Möglichkeiten, ein anderes Morgen zu gestalten . Wir liefern keine fertigen Antworten. Aber wir öffnen Denkräume. Und das ist der Anfang von allem. Diese Folge macht deutlich: Die Verkehrswende ist kein rein technisches Projekt , sondern eine zutiefst soziale und kulturelle Aufgabe . Wer von „Verzicht“ spricht, verschweigt oft, dass viele längst verzichten müssen – auf Sicherheit, Zugang, Bewegungsfreiheit. Und wer von „Freie Fahrt für freie Bürger“ redet, meint oft: Freiheit für eine sehr kleine, sehr laute Gruppe.…
s
she drives mobility
1 Panzer statt Züge - Kassiert die Zeiten- die sozial gerechte Verkehrswende? Eine Einladung zur Besonnenheit. 39:12
39:12  التشغيل لاحقا
التشغيل لاحقا  التشغيل لاحقا
التشغيل لاحقا  قوائم
قوائم  إعجاب
إعجاب  احب39:12
احب39:12
Schön, dass du reinschaltest! Meine Arbeit generiert dir Mehrwerte? Dann freue ich mich über weiteren Support! Meinen wöchentlichen Newsletter gibt es bei steady . Ab sofort lohnt sich ein Newsletter noch mehr, weil ich alle 14 Tage Videopodcasts meiner Interviewpartner*innen aus „Raus aus der AUTOkratie – rein in die Mobilität von morgen!“ exklusiv für meine Abonnent*innen zur Verfügung stelle. Meine kleine She Drives Mobility Academy soll Wissen und Mut vervielfältigen und für Vernetzung sorgen. Vor allem das Paket für 24 Euro im Monat für fünf Personen könnte also etwas für euch als Freund*innnen oder Kolleg*innen sein, um gemeinsam sich inspirieren zu lassen! Im Mai kommt mein erstes Kinderbuch – bestell´ es gern schon vor! Meinen Podcast schon abonniert? Wenn dir diese oder auch eine andere Folge gefällt, lass´ gern eine Bewertung da und/oder supporte mich per Ko-Fi oder PayPal . Anfragen an backoffice@katja-diehl.de. Wenn du Lust hast, über nachhaltige Mobilität, gesellschaftlichen Wandel und die Absurditäten des Status quo nachzudenken – willkommen! Falls du der Meinung bist, das Auto sei unantastbar und Veränderung grundsätzlich überflüssig, dann wird das hier vielleicht herausfordernd für dich … aber genau darum geht es ja! Und natürlich lässt du dich gern herausfordern! Oder? 😉 In dieser Folge spreche ich mit Tobi Rosswog über das, was uns beide antreibt: die Verkehrswende als Teil eines größeren gesellschaftlichen Wandels. Warum hängt unsere Infrastruktur so krass am Auto? Wieso tun sich Politik und Wirtschaft so schwer, echte Alternativen zu schaffen? Und warum bedeutet „freie Wahl“ in der Mobilität für viele Menschen eigentlich das Gegenteil? Wir nehmen euch mit in eine ehrliche, manchmal emotionale, aber immer lösungsorientierte Diskussion über die Zukunft der Mobilität – und warum sie viel mehr ist als nur eine technische Frage. Du erfährst mehr darüber: Warum unser Verkehrssystem nicht für Menschen gemacht ist Wir starten direkt mit der großen Frage: Wieso sieht unsere Welt so aus, als hätte das Auto immer Priorität? Und was bedeutet das für alle, die sich nicht ins Blech setzen wollen oder können? System Change, not Climate Change Tobi bringt es auf den Punkt: Wir müssen aufhören, nur über individuelle Entscheidungen zu sprechen. Das Problem ist nicht, dass einzelne Menschen zu viel Auto fahren – sondern dass unser System das Auto zum Standard gemacht hat. Der Mythos der „freien Wahl“ Ich erzähle, warum viele Menschen gar keine echte Wahl haben, wenn es um Mobilität geht – und warum wir dringend daran arbeiten müssen, das zu ändern. Wie sieht eine gerechte Verkehrswende aus? Hier wird’s konkret: Was machen Städte, die den Wandel bereits geschafft haben, anders? Welche Infrastruktur brauchen wir, um weniger Auto und mehr Lebensqualität zu denken? Fünf Zitate, die dir ein Gefühl geben, wie das Gespräch verläuft: Tobi: „Wenn du mehr Straßen baust, bekommst du mehr Verkehr. Wenn du mehr Zugverbindungen schaffst, bekommst du mehr Bahnfahrer:innen. So einfach ist das.“ 👉 Infrastruktur schafft Verhalten – nicht umgekehrt. Tobi: „Die Politik sagt, sie wolle Verkehr reduzieren – und subventioniert gleichzeitig Dienstwagen. Wer soll das verstehen?“ 👉 Ein perfektes Beispiel für das „eine sagen und das andere tun“-Prinzip. Ich: „Die beste Verkehrswende ist die, die gar nicht auffällt – weil alle einfach sicher und bequem von A nach B kommen.“ 👉 Ich will, dass sich Mobilität einfach gut anfühlt, ohne dass wir dauernd über sie nachdenken müssen. Ich: „Wir haben eine Auto-Lobby, die Milliarden bekommt – und eine Fuß- und Radlobby, die aus Ehrenamtlichen besteht. Fair ist das nicht.“ 👉 Das Ungleichgewicht in der Verkehrspolitik muss endlich thematisiert werden. Wir: „Es geht nicht um das einzelne Auto. Es geht um die Frage: Wie wollen wir leben?“ 👉 Mobilität ist kein Selbstzweck. Es geht darum, unsere Städte und unser Leben besser zu gestalten. Tobi und mich eint, dass wir über Mobilität als gesellschaftliche Frage sprechen – und nicht nur über technische Lösungen. Wenn du Lust auf neue Perspektiven hast, hör unbedingt rein! Für Barrierefreiheit, zum Sprachen lernen oder einfach zum mitlesen: Hier findet ihr das vollständige Transkript zur Folge: Hier gehts zum Transkript Transkription unterstützt durch AI Algorithmen von Presada (https://www.linkedin.com/company/presadaai/)…
s
she drives mobility
1 Zwischen Polizeiuniform und Klimaprotest – Wie Dialog Veränderung ermöglicht und neue Banden bildet. 1:15:32
1:15:32  التشغيل لاحقا
التشغيل لاحقا  التشغيل لاحقا
التشغيل لاحقا  قوائم
قوائم  إعجاب
إعجاب  احب1:15:32
احب1:15:32
Schön, dass du reinschaltest! Meine Arbeit generiert dir Mehrwerte? Dann freue ich mich über weiteren Support! Meinen wöchentlichen Newsletter gibt es bei steady . Ab sofort lohnt sich ein Newsletter noch mehr, weil ich alle 14 Tage Videopodcasts meiner Interviewpartner*innen aus „Raus aus der AUTOkratie – rein in die Mobilität von morgen!“ exklusiv für meine Abonnent*innen zur Verfügung stelle. Meine kleine She Drives Mobility Academy soll Wissen und Mut vervielfältigen und für Vernetzung sorgen. Vor allem das Paket für 24 Euro im Monat für fünf Personen könnte also etwas für euch als Freund*innnen oder Kolleg*innen sein, um gemeinsam sich inspirieren zu lassen! Im Mai kommt mein erstes Kinderbuch – bestell´ es gern schon vor! Meinen Podcast schon abonniert? Wenn dir diese oder auch eine andere Folge gefällt, lass´ gern eine Bewertung da und/oder supporte mich per Ko-Fi oder PayPal . Meine aktuellen Lesungen und Vorträge findet ihr immer hier . Anfragen als Speakerin an backoffice@katja-diehl.de. In dieser Folge von She Drives Mobility habe ich zwei beeindruckende Frauen zu Gast, die auf den ersten Blick aus völlig gegensätzlichen Welten kommen: Hannah , Klimaaktivistin, die sich seit Jahren für Klimagerechtigkeit einsetzt, und Chiara , Polizistin, die das System, in dem sie arbeitet, zunehmend hinterfragt. Was als „digitale Konfrontation“ begann – Hannah postete einen Beitrag zum „All Cops Are Bastards“-Tag, der von Chiara gelesen und hinterfragt wurde – entwickelte sich zu einem Gespräch, das zeigt, wie Brücken gebaut werden können, wenn man bereit ist, sich aufeinander einzulassen. Heute sind die beiden befreundet, klären gemeinsam auf und haben sogar ein Buch über ihre Erfahrungen geschrieben. Wir sprechen über ihre unterschiedlichen Hintergründe und darüber, was sie jeweils dazu bewegt hat, sich gesellschaftlich zu engagieren. Wie ist es, als Klimaaktivistin in einem Staat zu agieren, der immer stärker gegen Proteste vorgeht? Welche Konflikte entstehen, wenn man als Polizistin plötzlich die Strukturen hinterfragt, in denen man arbeitet? Und welche Rolle spielt unser eigenes Denken dabei, wenn es darum geht, Veränderungen überhaupt für möglich zu halten? Im Laufe des Gesprächs geht es um Vorurteile, systemische Ungerechtigkeiten, Polizeigewalt, Aktivismus und die Frage, wie echte Sicherheit geschaffen werden kann . Wir diskutieren darüber, warum wir uns oft gegeneinander ausspielen lassen, statt solidarisch für eine bessere Welt zu kämpfen. Und wir fragen uns, wie eine Gesellschaft aussehen könnte, in der Menschen nicht nach Verwertbarkeit beurteilt werden, sondern nach ihren Bedürfnissen und Potenzialen. Drei Zitate aus unserem Gespräch: Hannah: „Wir stecken alle kollektiv in einer Shit-Show.“ – Ein ehrlicher Blick darauf, wie unser Wirtschaftssystem, die Klimakrise und soziale Ungerechtigkeit miteinander verwoben sind – und warum der Kampf für Veränderung in allen Bereichen geführt werden muss. Chiara: „Regeln sind menschengemacht.“ – Ihr persönlicher Wendepunkt, als sie erkannte, dass Gesetze und Strukturen nicht unveränderlich sind, sondern von Menschen geschaffen und damit auch veränderbar sind. Katja: „Eine Utopie muss nicht eins zu eins umgesetzt werden, aber wir brauchen einen Ort, zu dem wir hinwollen.“ – Warum Visionen für eine bessere Gesellschaft nicht naiv, sondern notwendig sind, um Veränderungen zu ermöglichen. Unser Gespräch zeigt: Wandel beginnt, wenn wir uns auf Augenhöhe begegnen, den Dialog suchen und bereit sind, unsere eigenen Vorurteile zu hinterfragen. Wenn euch diese Folge gefällt, teilt sie, abonniert den Podcast und lasst eine Bewertung da! Für Barrierefreiheit, zum Sprachen lernen oder einfach zum mitlesen: Hier findet ihr das vollständige Transkript zur Folge: Hier gehts zum Transkript Transkription unterstützt durch AI Algorithmen von Presada (https://www.linkedin.com/company/presadaai/)…
s
she drives mobility
1 Die Sprache des Kapitalismus - neue Narrative raus aus der gefühlten kapitalistischen Alternativlosigkeit! 52:06
52:06  التشغيل لاحقا
التشغيل لاحقا  التشغيل لاحقا
التشغيل لاحقا  قوائم
قوائم  إعجاب
إعجاب  احب52:06
احب52:06
Meinen wöchentlichen Newsletter gibt es bei steady . NEWS! Ab sofort lohne sich ein Newsletter noch mehr, weil ich alle 14 Tage Videopodcasts meiner Interviewpartner*innen aus „Raus aus der AUTOkratie – rein in die Mobilität von morgen!“ exklusiv für meine Abonnent*innen zur Verfügung stellen werde. Meine kleine She Drives Mobility Akademie soll Wissen und Mut vervielfältigen und für Vernetzung sorgen. Vor allem das Paket für 24 Euro im Monat für fünf Personen könnte also etwas für euch als Freund*innnen oder Kolleg*innen sein, um gemeinsam sich inspirieren zu lassen! Im Mai kommt mein erstes Kinderbuch – bestell´ es gern schon vor! Meinen Podcast schon abonniert? Wenn dir diese oder auch eine andere Folge gefällt, lass´ gern eine Bewertung da und/oder supporte mich per Ko-Fi oder PayPal . Meine aktuellen Lesungen und Vorträge findet ihr immer hier . Anfragen als Speakerin an backoffice@katja-diehl.de. „Die Sprache des Kapitalismus“ von Simon Sahner und Daniel Stähr wurde ebenso wie mein erstes Buch mit dem Leserpreis des Deutschen Wirtschaftsbuchpreises ausgezeichnet. Wir müssen anders über Geld und Wirtschaft sprechen, wenn wir zu einem gerechteren Miteinander gelangen wollen! Daher sind Simon und Daniel perfekte Gäste, denn auch in der Mobilität steckt sprachlich viel, was das Auto als unveränderbare Basis von Mobilität framt, obwohl ein Drittel der Deutschen gar nicht Auto fahren kann. Die tief verwurzelten Narrative des Kapitalismus haben massiven (gewünschten) Einfluss auf unsere Gesellschaft, insbesondere auf Mobilität und soziale Gerechtigkeit. Sie zeigen den Kapitalismus und den Status Quo als etwas Unveränderbares, was eine Lüge ist, aber Menschen wie Elon Musk und anderen faschistischen Überreichen sehr in die Karten spielt. Gemeinsam hinterfragen wir daher die bestehenden Systeme und zeigen auf, warum es so wichtig ist, Sprache als Werkzeug des Wandels zu nutzen. Zentrale Themen: Die Macht der Sprache: Wie Begriffe wie „Arbeitgeber“ und „Arbeitnehmer“ unsere Sicht auf Arbeit verzerren und bestehende Machtverhältnisse zementieren. Sprache beeinflusst, wie wir Systeme wahrnehmen und welche Veränderungen wir für (un-)möglich halten. Kapitalismus und Innovation: Warum Märkte nicht immer der beste Mechanismus zur Allokation von Ressourcen sind und welche Alternativen es gibt. Es wird deutlich, dass Märkte oft soziale Ungleichheiten verstärken, anstatt Innovation und Wohlstand gerecht zu verteilen. Mobilität und Systemrelevanz: Wie die Autoindustrie als systemrelevant dargestellt wird, während essenzielle Berufe wie Pflege unterbewertet und unterbezahlt bleiben. Dieses Ungleichgewicht verdeutlicht, dass Systemrelevanz oft nicht an den tatsächlichen gesellschaftlichen Bedürfnissen ausgerichtet ist. Positive Narrative für die Zukunft: Es ist daher immens wichtig, neue, hoffnungsvolle Erzählungen zu schaffen. Diese Narrative können Mut machen, Alternativen zum bestehenden kapitalistischen System zu denken und umzusetzen. Zitate: Simon Sahner: „Die Art, wie wir über Dinge sprechen, zementiert ihre Wahrnehmung – Sprache ist eine Säule des kapitalistischen Systems.“ „Systemrelevanz sollte sich an den Bedürfnissen der Menschen orientieren – und nicht an wirtschaftlichen Interessen.“ „Wir brauchen positive Erzählungen einer Welt jenseits des Kapitalismus.“ Daniel Stähr: „Märkte sind eine großartige Erfindung – aber nicht für lebensnotwendige Dinge wie Wohnen oder Gesundheit.“ „Das Narrativ vom ‚Too Big to Fail‘ schafft Anreize für Unternehmen, Risiken einzugehen, weil sie sich auf staatliche Rettung verlassen.“ „Wir brauchen mehr Wasser und weniger Diamanten – eine faire Preisgestaltung, die den gesellschaftlichen Nutzen widerspiegelt.“ Katja Diehl: „Wir müssen Mobilität als ein grundlegendes Menschenrecht verstehen, das allen offenstehen muss.“ (00:02:15) „Es gibt nie zu wenig Parkraum – es gibt zu wenig Lebensraum in Städten.“ „Es macht viel mehr Spaß, die Welt zu gestalten, als gestaltet zu werden.“ Ich hoffe, dass diese Episode euch zum Nachdenken anregt und einlädt, bestehende Systeme und Sprachmuster zu hinterfragen. Unsere Diskussion zeigt, wie sehr Narrative unser Handeln und unsere Vorstellungen beeinflussen – und warum es an der Zeit ist, neue Erzählungen zu schaffen, die soziale Gerechtigkeit und nachhaltige Entwicklung in den Mittelpunkt stellen. Ja! Es braucht Mut, bestehende Systeme zu hinterfragen und neue Wege zu gehen. Dabei ist es entscheidend, die richtigen Fragen zu stellen und eine Vision zu entwickeln, die sich an den Bedürfnissen aller Menschen orientiert. Diese Episode ist ein Aufruf, aktiv zu werden und gemeinsam an einer gerechteren und nachhaltigeren Zukunft zu arbeiten. Meine Gäste: Simon Sahner: Freier Autor, Lektor und Moderator, Mitbegründer des Online-Magazins 54books. Simon bringt die sprachwissenschaftliche und kulturelle Perspektive in das Gespräch ein und analysiert, wie Begriffe und Narrative unsere Wahrnehmung prägen. Daniel Staehr: Ökonom und Essayist, spezialisiert auf Narrative Economics. Daniel hinterfragt wirtschaftliche Erzählungen und erklärt, wie sie politische und gesellschaftliche Entscheidungen beeinflussen. Für Barrierefreiheit, zum Sprachen lernen oder einfach zum mitlesen: Hier findet ihr das vollständige Transkript zur Folge: Hier gehts zum Transkript Transkription unterstützt durch AI Algorithmen von Presada (https://www.linkedin.com/company/presadaai/)…
s
she drives mobility
1 Dana "Herzkater": Wo finde ich rechtzeitig die STOP-Taste, bevor ich über meine eigenen Grenzen gehe? 1:01:48
1:01:48  التشغيل لاحقا
التشغيل لاحقا  التشغيل لاحقا
التشغيل لاحقا  قوائم
قوائم  إعجاب
إعجاب  احب1:01:48
احب1:01:48
„Raus aus der AUTOkratie – rein in die Mobilität von morgen!“ . Schon gelesen? Im Mai kommt mein erstes Kinderbuch – bestell´ es gern schon vor! Meinen Podcast schon abonniert? Wenn dir diese oder auch eine andere Folge gefällt, lass´ gern eine Bewertung da und/oder supporte mich per Ko-Fi oder PayPal . Meinen wöchentlichen Newsletter gibt es bei steady . Meine aktuellen Lesungen und Vorträge findet ihr immer hier . Anfragen als Speakerin an backoffice@katja-diehl.de. Dana Buchzik – Journalistin, Autorin und Expertin für Radikalisierung, Kommunikation und gesunde Abgrenzung – bei Instagram unter dem Accountnamen Herzkater zu finden, wurde in einer Sekte groß und hat sich auch wegen dieser Vergangenheit viel mit Radikalisierung der Gesellschaft, aber auch des familiären Umfeldes beschäftigt. Ihr Anliegen ist es, Menschen Hilfe zu geben, die sich von Polarisierung in Zeiten multipler Krisen überfordert fühlen. Ihr neues Buch „ The Power of No – Warum wir endlich unbequem werden müssen “ plädiert sie für eine neue Art des Neinsagens . Darüber habe ich mit ihr gesprochen. Wir sprechen über die Mechanismen von Radikalisierung, die Rolle von Sprache und Framing, die Schwierigkeit, gesunde Grenzen zu setzen – insbesondere für Menschen in aktivistischen und sozialen Berufen – und die Bedeutung einer effektiven, respektvollen Kommunikation. Die politische und gesellschaftliche Lage in Deutschland, zunehmende Radikalisierung und Polarisierung – all das muss nicht nur verstanden, sondern auch verarbeitet werden. Mit Grenzen, die wir nur selbst wahren und definieren können. Radikalisierung: Warum Menschen in extreme Denkmuster abrutschen Frühe Anzeichen werden oft übersehen: Dana beschreibt, dass Radikalisierung schleichend passiert. Erste problematische Äußerungen werden oft ignoriert, bis es zu extremen Positionen kommt. Emotionen vs. Fakten: Menschen halten besonders stark an Meinungen fest, die mit intensiven Emotionen verknüpft sind – selbst wenn sie objektiv falsch sind. Die Rolle von Angst: Radikale Gruppen nutzen Ängste gezielt, um Menschen zu mobilisieren, während progressive Bewegungen oft Schwierigkeiten haben, emotionale Narrative zu schaffen. Die Normalisierung rechter Sprache: Katja beschreibt, wie sie zunehmend AfD-Framing in alltäglichen Gesprächen bemerkt und warum das gefährlich ist. Zitat von Dana: „Radikale Gruppen arbeiten mit Angst, und Angst bringt Menschen in Bewegung – leider oft in die falsche Richtung.“ Zitat von Katja: „Ich höre im Alltag immer öfter AfD-Sprech – ohne, dass es jemand merkt oder infrage stellt.“ Gesunde Grenzen: Warum sie so schwer zu setzen sind Soziale Prägung von Frauen: Dana erklärt, dass besonders Frauen früh lernen, sich zurückzunehmen und eigene Bedürfnisse zu vernachlässigen. Abgrenzung ist kein Egoismus: Grenzen setzen wird oft als unhöflich oder unsolidarisch wahrgenommen, ist aber essenziell für die eigene psychische Gesundheit. Orange vs. rote Linien: Kleine Warnsignale (orange Linien) sollten ernst genommen werden, bevor sie zur totalen Erschöpfung (rote Linie) führen. Aktivismus und Burnout: Katja und Dana sprechen über den enormen Druck, ständig „funktionieren“ zu müssen, und die Schwierigkeit, sich bewusst Pausen zu nehmen. Zitat von Dana: „Wir überschreiten unsere Grenzen nicht mit einem großen Sprung, sondern in vielen kleinen Schritten – bis wir plötzlich nicht mehr können.“ Zitat von Katja: „Ich werde für das Gleiche kritisiert, für das ein Mann Applaus bekommt – das ist die Realität meiner Arbeit. Kommunikation: Warum wir aneinander vorbeireden Warum Argumente allein nicht reichen: Beziehungen sind oft wichtiger als rationale Fakten, wenn es darum geht, Menschen zum Umdenken zu bewegen. Die Schwierigkeit, gehört zu werden: Katja spricht über ihre Erfahrung, dass viele Menschen Veränderung zwar wollen, aber nicht bereit sind, selbst etwas dafür zu tun. Empathie als Werkzeug: Dana betont, dass wir Menschen in radikalen Gruppen nicht mit Hass begegnen sollten, sondern durch eine Mischung aus Abgrenzung und Beziehungsangeboten. Die Stille der Befürworter: Veränderungswillige Menschen äußern sich oft nicht lautstark, während Gegner von Veränderungen besonders aktiv sind. Zitat von Dana: „Gegen Argumente sind Menschen irgendwann immun – aber nicht gegen Gefühle.“ Zitat von Katja: „Menschen, die Veränderungen wollen, schweigen oft – während die, die am Status quo festhalten, laut sind.“ Persönliche Erfahrungen und Strategien Kritik und Anfeindungen: Katja spricht über ihre Erfahrungen mit Hassnachrichten und der Notwendigkeit, sich abzugrenzen. Der schwierige Umgang mit ehemaligen Freundschaften: Beide reflektieren, wie sich ihr Umfeld durch ihre Arbeit verändert hat und warum manche Menschen nicht mitgehen können. Praktische Tipps für den Alltag: Dana gibt konkrete Vorschläge, wie man eigene Grenzen besser erkennen und setzen kann – etwa durch bewusste Pausen oder klare Formulierungen. Zitat von Dana: „Selbstfürsorge ist kein Luxus – wenn wir ausbrennen, kann niemand von uns mehr für Veränderung kämpfen.“ Zitat von Katja: „Ich habe meinen gesamten Bekanntenkreis umgestellt, weil ich mich nicht mehr mit Menschen umgeben will, die mich in meiner Arbeit nicht ernst nehmen.“ Warum dieses Thema wichtig ist : Die Themen Radikalisierung, Sprache und persönliche Grenzen sind eng miteinander verbunden. Gesellschaftliche Veränderung braucht nicht nur Aktivismus, sondern auch Selbstschutz und kluge Kommunikation. Veränderung beginnt bei jedem Einzelnen – und manchmal bedeutet das, sich aktiv abzugrenzen. Abschließendes Zitat von Dana: „Grenzen zu setzen bedeutet nicht, Menschen abzulehnen – es ist ein Zeichen von Respekt und Selbstschutz.“ Fünf weitere Zitate von Dana: „Wir alle glauben eher Dinge, die zu unserer Meinung passen. Aber reflektieren wir das auch?“ Dana spricht hier über die menschliche Neigung zur Bestätigung des eigenen Weltbildes (Confirmation Bias) und warum es wichtig ist, bewusst gegen diese Tendenz anzugehen. „Viele Frauen wachsen mit der Erfahrung auf, dass ihre Grenzen nicht zählen – sei es in der Familie, im Beruf oder in der Gesellschaft.“ Hier geht es um soziale Prägungen und wie Frauen oft schon früh lernen, ihre eigenen Bedürfnisse hintanzustellen. „Radikale Gruppen arbeiten mit Angst, und Angst bringt Menschen in Bewegung – leider oft in die falsche Richtung.“ Dana erklärt, warum rechte Bewegungen so erfolgreich mobilisieren können und warum progressiven Bewegungen oft das emotionale Framing fehlt. „Gesunde Abgrenzung ist kein Egoismus – es ist ein Akt der Selbstfürsorge und der Respekt vor sich selbst.“ Ein zentraler Punkt in Danas Buch: Wer sich nicht abgrenzt, verliert sich selbst in der Erfüllung externer Erwartungen. „Wir überschreiten unsere Grenzen nicht mit einem großen Sprung, sondern in vielen kleinen Schritten – bis wir plötzlich nicht mehr können.“ Dana spricht über die schleichende Erschöpfung, besonders in sozialen Berufen und im Aktivismus. Meine Gedanken zu Grenzen: „Ich merke immer wieder, dass viele Menschen Veränderung wollen – aber bitte nicht zuerst bei sich selbst.“ Ich reflektiere meine Erfahrung mit Menschen, die sich zwar theoretisch für nachhaltige Mobilität aussprechen, aber keine persönlichen Konsequenzen daraus ziehen. „Mir wurde gesagt, ich solle mir überlegen, wie ich mich verhalte, um weniger Morddrohungen zu bekommen. Das ist Täter-Opfer-Umkehr in Reinform.“ Ich berichte von meinen häufigen Erfahrungen mit Victim Blaming, die zeigen, wie Normalisierung von Gewalt gegen Aktivist*innen stattfindet. „Wenn du die Welt verändern willst, musst du damit leben, dass viele Menschen dich missverstehen oder deine Erfahrungen mit Hass kleinreden.“ Eine bittere, aber realistische Einschätzung, die ich wegen meines Status´ als „öffentliche Person“ machen musste, auch bei Personen, die mir mal nahestanden. „Selbstfürsorge ist kein Luxus – wenn wir ausbrennen, kann niemand von uns mehr für Veränderung kämpfen.“ Aktivismus und nachhaltiges Engagement : Lessons, lessons, lessons. Für Barrierefreiheit oder zum Sprachen lernen: Hier findet ihr das vollständige Transkript zur Folge: Hier gehts zum Transkript Transkription unterstützt durch AI Algorithmen von Presada (https://www.linkedin.com/company/presadaai/)…
s
she drives mobility
1 Von Mobilitätspolitik und Unschuldsvermutung - Kerstin Finkelstein und Jan Rosenkranz sprechen mit Stefan Gelbhaar. 1:17:40
1:17:40  التشغيل لاحقا
التشغيل لاحقا  التشغيل لاحقا
التشغيل لاحقا  قوائم
قوائم  إعجاب
إعجاب  احب1:17:40
احب1:17:40
„Raus aus der AUTOkratie – rein in die Mobilität von morgen!“ . Schon gelesen? Meinen Podcast schon abonniert? Wenn dir diese oder auch eine andere Folge gefällt, lass´ gern eine Bewertung da und/oder supporte mich per Ko-Fi oder PayPal . Meinen wöchentlichen Newsletter gibt es bei steady . Meine aktuellen Lesungen und Vorträge findet ihr immer hier . Anfragen als Speakerin an backoffice@katja-diehl.de. Solltest du von sexualisierter Gewalt betroffen sein und Hilfe suchen, findest du hier telefonische, elektronische Beratung und weitere Hilfsangebote. Vorab: Mir ist bewusst, dass die Vorwürfe gegen Stefan Gelbhaar nicht vom Tisch sind und dringend bis zum letzten Detail aufgeklärt werden müssen. Der Grund, warum ich mich zu diesem Gespräch entschlossen habe, war eine Entwicklung, die ich als sehr problematisch erachte: Das Rütteln an der Unschuldsvermutung . Wenn wir eine gute Welt für alle schaffen wollen, dann muss die Unschuldsvermutung am Beginn nicht nur von Vorwürfen sexualisierter Gewalt, die platziert werden, endlich für beide Seiten gelten: Für Täter*innen wie Betroffene gleichermaßen. Das aktuelle System ist massiv dysfunktional, viele Betroffene von sexualisierter Gewalt zeigen daher auch gar nicht an, was ihnen geschehen ist – weil sie den Gang in die Öffentlichkeit, zur Polizei scheuen. Aufgrund negativer Erfahrungen und vor allem einer Herabwürdigung, die diesem System gegenüber traumatisierten Opfern sexualisierter Gewalt immanent ist. Das System von Polizei über Gesellschaft bis Justiz verunmöglicht es, guten und sensiblen Umgang mit Opfern zu gewährleisten. Das sehen wir nicht zuletzt an den vielen prominenten Herren, die Vorwürfen deutlich ausgesetzt waren, aber heute vor noch gefüllteren Hallen stehen und ihre Shows abliefern können. Während die Opfer in Vergessenheit gerieten, diffamiert wurden. Die Scham hat hier immer noch nicht die Seiten gewechselt, auf Seiten der Täter*innen, wo sie hingehört. Ich hoffe, dass wir das endlich besser hinbekommen. Die Unschuldsvermutung muss Zentrum eines besseren Systems sein. Aufklärung und bessere Strukturen für die Aufklärung müssen etabliert werden. Wenn sich junge Frauen der Grünen zitieren lassen mit: Die Unschuldsvermutung gilt nur vor Gericht, aber nicht in einer Partei. dann ist das – korrigiert mich gern, wenn ihr das anders seht – mehr Schaden als Heilung. Eben WEIL wir wollen, dass es fair zugeht. Da darf es nicht als unproblematisch erachtet werden, dass angebliche Beweise sich als Fälschung erweisen, sogar die Person, die eidesstattliche Versicherungen einreichte, weder vom rbb noch seinem Justiziariat überprüft wurde. Das hilft Jenen, die weiterhin wollen, dass die Scham bei den Betroffenen bleibt. Es MUSS dringend aufgeklärt werden, welche Vorwürfe gegenüber Stefan Gelbhaar berechtigt sind. Und diese müssen dann auch Konsequenzen haben. Aber wir alle sind angehalten, uns trotz aller Wut über die Ungerechtigkeiten, die FLINTAs im Laufe ihres Lebens täglich ansammeln müssen, nicht über grundsätzliche Rechte, die allen gebühren, hinwegzusetzen. Zur Episode: Kerstin Finkelstein im Gespräch mit Stefan Gelbhaar über die Mobilitätspolitik der Ampelregierung. Die Novelle des Straßenverkehrsgesetzes ist ein Fortschritt, weil sie neue Kriterien wie Gesundheitsschutz und Stadtentwicklung einführt. Allerdings ist die Umsetzung noch kompliziert, da Bundesrat und Bundesregierung hier Einfluss haben. Stefan Gelbhaar hebt hervor, dass die Verkehrswende nicht nur eine ökologische, sondern auch eine soziale Frage ist. Subventionen für den Autoverkehr belasten den Staat mit Milliardenbeträgen, während nachhaltige Mobilitätslösungen unterfinanziert bleiben. Die Bahn wurde jahrzehntelang vernachlässigt. Es gibt massive Investitionsrückstände, veraltete Stellwerke, Weichen und Gleise. Stefan Gelbhaar erklärt, dass die aktuelle Regierung zwar mehr Mittel bereitstellt, aber Jahre der Unterfinanzierung nicht sofort ausgleichen kann. Dennoch ist die Nachfrage nach Bahnreisen hoch, und eine langfristige Förderung der Schieneninfrastruktur ist essenziell. Stefan Gelbhaar reflektiert auch über die politischen Prozesse hinter den Kulissen. Die Verhandlungen um das Verkehrsministerium führten dazu, dass die FDP es übernahm – eine Entscheidung, die viele in der Verkehrswende-Bewegung enttäuschte. Er betont, dass politische Entscheidungen oft durch Koalitionsdynamiken geprägt sind und nicht immer einer Partei allein zuzuschreiben sind. Jan Rosenkranz im Gespräch mit Stefan Gelbhaar. Jan Rosenkranz beginnt mit der Frage, wie sich Stefan Gelbhaar aktuell fühlt – zwischen dem Wissen, dass er sich nicht mehr für den Bundestag zur Wahl stellen wird, und dem abrupten Ende seiner politischen Karriere. Jan Rosenkranz fasst zusammen, was passiert ist: Kurz vor der Listenaufstellung der Berliner Grünen für die Bundestagswahl tauchten erste Vorwürfe gegen Gelbhaar auf. Es ging um Belästigungsvorwürfe, von denen einige später als erfunden entlarvt wurden. Einige Frauen blieben bei ihren Vorwürfen, die sich auf unangemessenes Verhalten bezogen. Diese Meldungen wurden an die parteiinterne Ombudsstelle gegeben. Der RBB berichtete darüber und verstärkte die öffentliche Aufmerksamkeit. Gelbhaar beschreibt, wie schwer es war, sich gegen die Vorwürfe zu verteidigen, weil sie unkonkret blieben. Er verweist auf den kafkaesken Charakter der Situation: Er wusste nicht genau, was ihm vorgeworfen wurde, und konnte sich daher kaum äußern oder entlastende Fakten liefern. Gelbhaar betont, dass eine Ombudsstelle eine wertvolle Institution ist, da sie Betroffenen einen geschützten Raum bietet. Sie sei eine Anlaufstelle für Menschen, die sich unwohl fühlen oder grenzüberschreitendes Verhalten erlebt haben. In seinem Fall sei die Ombudsstelle überfordert gewesen: Die Vorwürfe wurden anonym gehalten, was bedeutete, dass er sich nicht konkret dazu äußern konnte. Die Ombudsstelle darf nicht mit einer Ermittlungsbehörde verwechselt werden – sie kann keine Beweise sammeln oder Fälle objektiv aufklären. Es braucht daher weitere Strukturen, die in solchen Fällen greifen. Da die aktuelle Struktur anfällig für gezielte Instrumentalisierung sein kann. Besonders problematisch war auch der Zeitpunkt der Vorwürfe, der kurz vor der Kandidatenaufstellung eine politische Dimension mit sich brachte. Jan Rosenkranz fragt nach, ob Stefan Gelbhaar überlegt, rechtliche Schritte gegen den RBB oder andere Beteiligte einzuleiten. Gelbhaar gibt an, dass er lange darüber nachgedacht habe. Erst als er in einem gerichtlichen Verfahren gegen den RBB Akteneinsicht bekam, erkannte er das gesamte Ausmaß der falschen Vorwürfe: Einige Aussagen stammten von einer Person, die es gar nicht gab. Es gab gefälschte eidesstattliche Erklärungen. Der RBB hatte sich auf unzureichend überprüfte Informationen gestützt. Er habe daraufhin den RBB juristisch zur Verantwortung gezogen, was schließlich dazu führte, dass die Falschvorwürfe öffentlich wurden. Jan Rosenkranz fragt, ob Gelbhaar sich von seiner Partei im Stich gelassen fühlt. Stefan Gelbhaar antwortet, dass es ein „dröhnendes Schweigen“ gegeben habe. Viele seien zurückhaltend gewesen, einige hätten sich aber auch solidarisch gezeigt. Besonders enttäuscht sei er darüber gewesen, dass der Bundesvorstand sich nicht früher klar positioniert habe. Robert Habeck sprach später von „krimineller Energie“, Parteikollege Felix Banaszak von „Niedertracht“. Stefan Gelbhaar nimmt dies zwar zur Kenntnis, betont aber, dass eine Entschuldigung nur sinnvoll sei, wenn sie auf einer ehrlichen und umfassenden Aufarbeitung beruhe. Stefan Gelbhaar betont, dass er das Thema sexueller Belästigung sehr ernst nimmt und für eine klare Aufarbeitung solcher Vorfälle auch in seinem Falle ist. Aber es müsse einen differenzierten Umgang mit Anschuldigungen geben, der sowohl den Betroffenen Schutz bietet als auch den Beschuldigten eine faire Möglichkeit zur Verteidigung einräumt. Jan Rosenkranz fragt zum Schluss, wie es für Stefan Gelbhaar weitergeht. Er antwortet, dass er sich zunächst mit der Aufarbeitung der Ereignisse beschäftigt. Der Vorfall habe ihm verdeutlicht, wie wichtig es sei, politische und mediale Mechanismen kritisch zu hinterfragen. Er sieht sich weiterhin als Teil der politischen Debatte und möchte sich für einen sachlichen, fairen Umgang mit Anschuldigungen und politischen Intrigen einsetzen. Für Barrierefreiheit oder zum Sprachen lernen: Hier findet ihr das vollständige Transkript zur Folge: Hier gehts zum Transkript Transkription unterstützt durch AI Algorithmen von Presada (https://www.linkedin.com/company/presadaai/)…
s
she drives mobility
1 Claudia Kemfert, Wolfgang Lucht: Wie bekommen wir in reaktionären Zeiten "das Klima" zurück in die Politik? 59:19
59:19  التشغيل لاحقا
التشغيل لاحقا  التشغيل لاحقا
التشغيل لاحقا  قوائم
قوائم  إعجاب
إعجاب  احب59:19
احب59:19
„Raus aus der AUTOkratie – rein in die Mobilität von morgen!“ . Schon gelesen? Meinen Podcast schon abonniert? Wenn dir diese oder auch eine andere Folge gefällt, lass´ gern eine Bewertung da und/oder supporte mich per Ko-Fi oder PayPal . Meinen wöchentlichen Newsletter gibt es bei steady . Meine aktuellen Lesungen und Vorträge findet ihr immer hier . Anfragen als Speakerin an backoffice@katja-diehl.de. In dieser Folge blicke ich mit Energieökonomie Claudia Kemfert, DIW-Abteilungsleiterin Energie, Verkehr, Umwelt, und dem Experten für systemische Umweltfragen Wolfgang Lucht vom Potsdam Institut für Klimafolgenforschung, zurück auf 2024 und auf das, was JETZT helfen würde, sich wieder auf die richtigen Themen zu fokussieren. Gemeinsam beleuchten wir verschiedene Facetten von politischen Hürden bis zu gesellschaftlichen Dynamiken, die eine gerechte und nachhaltige Transformation erschweren oder vorantreiben können. Unser Ziel: Nicht nur Analysen liefern, sondern auch ermutigende Perspektiven. Von der Kraft kleiner individueller Beiträge bis zur subversiven Macht von Ideen – und vor allem, dass Engagement und Zusammenarbeit die Basis für echten Wandel bilden. Wissenschaft und Aktivismus: Gegen den Widerstand Wie gehen wir als Wissenschaftler*innen und Aktivist*innen mit einer zunehmend wissenschaftsfeindlichen und polarisierten Umgebung um? Wolfgang erklärt, wie wichtig es ist, auch als Minderheit am Wandel festzuhalten, während wir gemeinsam über neue Strategien für Kommunikation und Organisation sprechen. Wolfgang bringt Suffizienz als mutige Strategie ins Spiel, und Claudia erklärt, welche politischen und gesellschaftlichen Hürden wir noch überwinden müssen. Dezentralisierung statt Ablenkung Warum schaffen es Randthemen wie Atomkraft immer wieder, wichtige Debatten zu verdrängen? Wolfgang entlarvt die Mechanismen dieser Ablenkungsdebatten, während Claudia die Vorteile von Bürgerräten und der stärkeren Einbindung von Bürger*innen betont. Ich schildere zudem, wie progressive Ideen, wie sie der grüne Oberbürgermeister von Hannover – Belit Onay – vertritt, trotz Widerständen Erfolg haben können. Wie schaffen wir Politik, die inspiriert? Wir sprechen über mutige Führungspersönlichkeiten wie Leonore Geversler und Anne Hidalgo, die durch ihre Visionen ganze Städte und Länder verändern. Gemeinsam überlegen wir, wie wir innovative Ideen in der Politik verankern und die Demokratie stärken können. Demokratie, Werte und Verantwortung Wolfgang zeigt, wie ökologische Verantwortung und demokratische Werte wie Gleichheit und Solidarität Hand in Hand gehen müssen. Wir diskutieren, warum wir uns von kurzfristigen Denkmustern lösen und auf langfristige, gerechte Lösungen setzen müssen. Wolfgang hebt die Kraft weiblicher Vordenkerinnen hervor, während Claudia und ich darüber sprechen, wie wichtig es ist, Perspektivwechsel zu fördern und neue Stimmen in den Diskurs einzubinden. Authentische Kommunikation statt polarisierender Algorithmen Gemeinsam analysieren wir, wie Algorithmen oft zu spalterischen Narrativen führen und warum wir stattdessen auf menschliche Geschichten und gemeinsame Werte setzen müssen. Unsere Themen: Klimagerechtigkeit und Planetare Grenzen: Wolfgang spricht über die Überschreitung ökologischer Grenzen und erklärt, warum Suffizienz – das Prinzip des „Genug“ – unverzichtbar für eine gerechte Zukunft ist. Er fordert ein Umdenken in Politik und Gesellschaft, das den ökologischen und sozialen Fußabdruck gleichermaßen berücksichtigt. Erfolge und Baustellen der Ampelregierung: Claudia lobt in ihrer Analyse der Ampelregierung Fortschritte im Ausbau erneuerbarer Energien, kritisiert jedoch den Stillstand bei der Verkehrswende und die populistische Debatte rund um Themen wie das Heizungsgesetz. Globale Klimagerechtigkeit und individuelle Verantwortung: Zusammen mit Claudia und Wolfgang spreche ich über den Aspekt der globalen Dimension und die Notwendigkeit, Privilegien zu hinterfragen, insbesondere im Kontext von Mobilitätsmustern und Konsum. Demokratie 2.0 und Bürger*innenbeteiligung: Claudia hebt die Rolle von Bürger*innenräten als innovative Möglichkeit hervor, breitere gesellschaftliche Akzeptanz und Partizipation zu fördern. Systemisches Denken und Transformation: Beide betonen die Bedeutung von langfristigen Visionen und systemischen Ansätzen, um Wachstum neu zu definieren und Machtstrukturen zu hinterfragen. Diese Episode bietet fundierte Einblicke, kritische Reflexion und pragmatische Ansätze für alle, die sich für Klimaschutz, soziale Gerechtigkeit und nachhaltige Mobilität interessieren. Ein Muss für alle, die verstehen wollen, warum Transformation Zeit braucht – und wie wir sie trotzdem vorantreiben können. „She Drives Mobility“ ist 2019 mein Podcast zu Mobilität, Klimaschutz und sozialer Gerechtigkeit aus intersektionalen Perspektive. Alle 14 Tage lade ich mir Expert*innen und Vordenker*innen ein, um die Herausforderungen und bestehenden Lösungen für eine wahlfreie Mobilität, die von Autobesitz befreit, zu beleuchten. Mit einem Fokus auf systemische und konkrete Ansätze sowie gerechte Transformationen inspiriert „She Drives Mobility“ klar, kritisch und visionär, die Veränderung schon morgen zu starten. Schreiben Sie mir unter backoffice@katja-diehl.de, wenn Sie eine Idee oder ein Unternehmen haben, das zu meinen Werten passt und unbedingt im Podcast als Gast oder Werbung stattfinden sollte! Für Barrierefreiheit oder zum Sprachen lernen: Hier findet ihr das vollständige Transkript zur Folge: Hier gehts zum Transkript Transkription unterstützt durch AI Algorithmen von Presada (https://www.linkedin.com/company/presadaai/)…
s
she drives mobility
1 Leo, der Freiheitsfonds und die Kriminalisierung von Fahren ohne Fahrschein - was tun gegen nazibasierte Autojustiz? 45:40
45:40  التشغيل لاحقا
التشغيل لاحقا  التشغيل لاحقا
التشغيل لاحقا  قوائم
قوائم  إعجاب
إعجاب  احب45:40
احب45:40
Mobilitätsgerechtigkeit und soziale Ungleichheit – Ein Gespräch mit Leo vom Freiheitsfonds „Raus aus der AUTOkratie – rein in die Mobilität von morgen!“ . Schon gelesen? Meinen Podcast schon abonniert? Wenn dir diese oder auch eine andere Folge gefällt, lass´ gern eine Bewertung da und/oder supporte mich per Ko-Fi oder PayPal . Meinen wöchentlichen Newsletter gibt es bei steady . Meine aktuellen Lesungen und Vorträge findet ihr immer hier . Anfragen als Speakerin an backoffice@katja-diehl.de. In dieser Episode spreche ich mit Leo vom Freiheitsfonds über die problematische Kriminalisierung von Fahren ohne Fahrschein und die tiefgreifenden Ungerechtigkeiten im deutschen Mobilitätssystem. Der Freiheitsfonds setzt sich dafür ein, Menschen aus der Haft zu befreien, die aufgrund von Ersatzfreiheitsstrafen einsitzen. Unsere Folge beleuchtet die Ursachen, Auswirkungen und Lösungen für Mobilitätsarmut. Diese Episode gibt Einblicke in die sozialen und rechtlichen Dimensionen von Mobilitätsungerechtigkeit und zeigt, wie solidarisches Handeln einen Unterschied machen kann. Hört rein und erfahrt, wie ihr selbst aktiv werden könnt, um die Mobilität in Deutschland gerechter zu gestalten! Werdet aktiv! Mobilitätsarmut als gesellschaftliches Problem Mobilitätsarmut ist nicht nur eine Frage des Geldes, sondern auch des fehlenden Zugangs zu öffentlichen Verkehrsmitteln in strukturschwachen Regionen. Das Fehlen günstiger und zugänglicher Alternativen zwingt viele Menschen zur Nutzung des Autos oder führt dazu, dass sie ohne Fahrschein unterwegs sind. Kriminalisierung von Armut Jährlich landen etwa 9.000 Menschen in Haft, weil sie sich weder Tickets noch die später verhängten Geldstrafen leisten können. Leo erläutert eindringlich, dass 87 % der Betroffenen arbeitslos und viele wohnungslos oder psychisch belastet sind. Statt Hilfe zu leisten, verschärft die Haft ihre ohnehin prekären Lebensbedingungen. Wurzeln des Problems im Rechtssystem Der Paragraph, der das Fahren ohne Fahrschein kriminalisiert, stammt aus der NS-Zeit (1935) und wurde ursprünglich für Automatenbetrug entwickelt. Diese veraltete Regelung bleibt bis heute unverändert bestehen und führt zu unverhältnismäßigen Strafen für Bagatelldelikte. Alternativen und Chancen durch Reformen Die Entkriminalisierung des Fahrens ohne Fahrschein könnte nicht nur Betroffenen helfen, sondern auch gesellschaftliche Kosten senken – ein Gefängnistag kostet rund 200 Euro. Leo und Katja sprechen über mögliche Lösungen, wie etwa die Einführung eines bundesweiten Sozialtickets, um Mobilität für alle erschwinglich zu machen. Gemeinschaftliches Engagement für Gerechtigkeit Der Freiheitsfonds konnte durch Spenden bereits über 1.200 Menschen aus der Haft freikaufen. Dennoch braucht es politische Lösungen, wie den aktuell im Bundestag diskutierten Gesetzesentwurf zur Entkriminalisierung. Katja und Leo rufen dazu auf, politisch aktiv zu werden, Abgeordnete anzuschreiben und sich für ein gerechteres Mobilitätssystem einzusetzen. Für Barrierefreiheit oder zum Sprachen lernen: Hier findet ihr das vollständige Transkript zur Folge: Hier gehts zum Transkript Transkription unterstützt durch AI Algorithmen von Presada (https://www.linkedin.com/company/presadaai/)…
s
she drives mobility
1 Radikale Zuversicht: Jagoda Marinić, Marina Weisband – was lässt euch positiv auf 2025 blicken? 1:00:53
1:00:53  التشغيل لاحقا
التشغيل لاحقا  التشغيل لاحقا
التشغيل لاحقا  قوائم
قوائم  إعجاب
إعجاب  احب1:00:53
احب1:00:53
„Raus aus der AUTOkratie – rein in die Mobilität von morgen!“ . Schon gelesen? Wenn dir diese oder auch eine andere Folge gefällt, lass´ gern eine Bewertung da und/oder supporte mich per Ko-Fi oder PayPal . Meinen wöchentlichen Newsletter gibt es bei steady . Meine aktuellen Lesungen und Vorträge findet ihr immer hier . Anfragen als Speakerin an backoffice@katja-diehl.de. Herzlich willkommen zur letzten Episode von She Drives Mobility in 2024. Ich habe mir zwei Wunschgästinnen eingeladen – und sie haben JA! gesagt. Unser Gespräch widmet sich der Frage, wie gesellschaftlicher Wandel konkret gestaltet werden kann. Wir diskutieren, wie Projekte, Visionen und individuelle Haltungen zusammenwirken, um eine gerechtere und demokratischere Gesellschaft zu schaffen. Drei Thesen von Marina: Frühe demokratische Bildung ist essenziell: Mit Projekten wie „Aula“ wird Schüler*innen früh ein Gefühl für Mitbestimmung und Verantwortung vermittelt. Negative Nachrichten dominieren unser Weltbild: Die mediale Fokussierung auf negative Ereignisse verzerrt die Wahrnehmung von Realität und führt zu Resignation. Veränderung beginnt bei uns selbst: Gesellschaftlicher Wandel setzt voraus, dass wir bereit sind, uns selbst zu hinterfragen und aktiv Verantwortung zu übernehmen. Über das Projekt Aula: „Aula“ ist ein digitales Beteiligungsprojekt für Schulen, das demokratische Entscheidungsprozesse praktisch erfahrbar macht. Schüler*innen haben die Möglichkeit, über eine digitale Plattform Ideen und Vorschläge einzubringen, die dann in einem demokratischen Prozess abgestimmt und umgesetzt werden. Ein Beispiel aus der Praxis zeigt, wie Schülerinnen durch Aula beschlossen haben, einen Teil des Schulhofs in einen Gemeinschaftsgarten umzuwandeln. Dieser wurde gemeinsam geplant und gestaltet, wodurch nicht nur praktische Fähigkeiten vermittelt, sondern auch ein starkes Gemeinschaftsgefühl geschaffen wurde. Drei Thesen von Jagoda: Orte des Wandels schaffen: Projekte wie das Internationale Welcome Center in Heidelberg zeigen, wie lokale Initiativen strukturelle Veränderungen bewirken können. Hybris vermeiden: Aktivismus muss demütig bleiben, um nicht von oben herab zu wirken und Widerstand hervorzurufen. Visionen praktisch umsetzen: Es reicht nicht, nur große Ideen zu kommunizieren – sie müssen konkret umgesetzt werden, um Vertrauen zu schaffen. Über das Haus der Begegnung: Das von Jagoda Marinić initiierte Haus der Begegnung in Heidelberg dient als ein Raum, in dem Menschen unterschiedlicher Hintergründe zusammenkommen, sich austauschen und gemeinsam Projekte realisieren können. Ein konkretes Beispiel war z. B. ein Projekt mit Taxifahrern, bei dem diese auf Fahrten durch die Stadt ihre Geschichten erzählten, die in Kurzfilmen festgehalten wurden. Diese Filme wurden im Kulturzentrum vorgeführt, wodurch eine neue Wertschätzung für die Erfahrungen und Perspektiven dieser Menschen entstand. Solche Projekte zeigen, wie informelle Lernräume geschaffen und kulturelle Ressourcen sichtbar gemacht werden können. Meine drei Thesen: Mobilität als Gerechtigkeitsfrage: Verkehrspolitik muss die Lebensrealitäten aller Menschen berücksichtigen, nicht nur die der Autofahrer*innen. Perspektivwechsel schaffen: Durch Geschichten und konkrete Beispiele kann man Menschen dazu bringen, strukturelle Probleme anders wahrzunehmen. Individuelles Handeln zählt: Auch wenn Veränderung systemisch notwendig ist, beginnt sie immer mit individuellen Entscheidungen. Unsere Quellen der Zuversicht und Kraft: Marina: Zuversicht schöpft sie aus den kleinen Erfolgen, die sie in den Schulen mit „Aula“ erlebt, und aus der Erkenntnis, dass Wandel bei jedem Individuum beginnt. Die Arbeit mit jungen Menschen, die plötzlich erkennen, dass ihre Stimme zählt, gibt ihr die nötige Kraft. Jagoda: Für sie liegt die Quelle ihrer Kraft in den Räumen, die sie geschaffen hat, in denen echte Begegnungen stattfinden. Sie sieht die Erfolge und Veränderungen auf lokaler Ebene und weiß, dass diese kleinen Erfolge die Grundlage für größere Veränderungen sind. Katja: Meine Zuversicht kommt aus der Überzeugung, dass Mobilität als Gerechtigkeitsfrage eine zentrale Rolle in einer inklusiven Gesellschaft spielt. Ich schöpfe meine Kraft aus den Geschichten und Rückmeldungen von Menschen, die durch meine Arbeit neue Perspektiven auf Mobilität erhalten haben. Fazit: Für uns drei ist es wichtig, dass gesellschaftlicher Wandel sowohl auf struktureller als auch auf individueller Ebene ansetzt. Projekte, die Beteiligung fördern, Visionen konkretisieren und Raum für neue Ideen schaffen, sind Schlüssel zur Gestaltung einer zukunftsfähigen Gesellschaft. Trotz Herausforderungen bleibt die Botschaft hoffnungsvoll: Wandel ist möglich, wenn Menschen den Mut haben, neue Wege zu gehen. Marina Weißband ist Publizistin und Expertin für Demokratiebildung. Seit 2014 leitet sie das von der Bundeszentrale für politische Bildung geförderte Projekt Aula – Schule gemeinsam gestalten, das Schüler ab der fünften Jahrgangsstufe dazu befähigen möchte, sich aktiv an der Gestaltung ihres schulischen Umfelds zu beteiligen und so demokratisches Handeln zu erproben. Jagoda Marinić hat unter anderem das Internationale Welcome Center in Heidelberg aufgebaut und ist Autorin mehrerer Bücher. Seit 2021 moderiert sie den Podcast Freiheit Deluxe. 2023 übernahm Marinić die künstlerische Leitung des Internationalen Literaturfestivals Heidelberg. Für Barrierefreiheit oder zum Sprachen lernen: Hier findet ihr das vollständige Transkript zur Folge: Hier gehts zum Transkript Transkription unterstützt durch AI Algorithmen von Presada (https://www.linkedin.com/company/presadaai/)…
s
she drives mobility
1 Christian Cohrs: Warum ist öffentlicher Nahverkehr nicht nur eine Frage der Infrastruktur, sondern auch der Gerechtigkeit? 1:42:00
1:42:00  التشغيل لاحقا
التشغيل لاحقا  التشغيل لاحقا
التشغيل لاحقا  قوائم
قوائم  إعجاب
إعجاب  احب1:42:00
احب1:42:00
„Raus aus der AUTOkratie – rein in die Mobilität von morgen!“ . Schon gelesen? Wenn dir diese oder auch eine andere Folge gefällt, lass´ gern eine Bewertung da und/oder supporte mich per Ko-Fi oder PayPal . Meinen wöchentlichen Newsletter gibt es bei steady . Anfragen als Speakerin oder Panelistin an backoffice@katja-diehl.de. Die Zusammenfassung liefert euch eine KI. Macht man ja heute so. ? Was hat das Deutschlandticket mit Demokratie zu tun? ? Warum sollte Mobilität als Grundrecht betrachtet werden? ? Wie brechen wir endlich die emotional Bindung ans Auto auf? ? Und: Warum sind Spaziergeh-Dates in Eimsbüttel keine gute Idee? Christian Cohrs interessiert sich für alles, das sich um Mobilität und digitale Innovation dreht. Als ehemaliger Host des Future Moves -Podcasts hat er mit über 100 Gästen spannende Einblicke in die Transformation der Verkehrswelt gesammelt – von Start-up-Gründern bis hin zu Kinderärzten. Und mit mir im Februar 2022. Hauptberuflich bei OMR tätig, einem führenden Medienunternehmen aus Hamburg, steht er für eine moderne, praxisnahe Perspektive auf Mobilität. Dabei interessiert ihn besonders, wie technologische und soziale Innovationen Mobilität zugänglicher, nachhaltiger und demokratischer machen können. Sein neuer Podcast „The Passenger“ geht noch diesen Monat online. 1. Die Demokratie der Mobilität Warum ist öffentlicher Nahverkehr nicht nur eine Frage der Infrastruktur, sondern auch der Gerechtigkeit? Katja und Christian diskutieren: Barrierefreiheit: Wie kann Mobilität für alle zugänglich sein – von Kindern bis zu älteren Menschen? Katja erzählt, wie sie erlebt hat, dass Menschen durch On-Demand-Shuttles zum ersten Mal zur Tafel fahren konnten, weil sie sich das Deutschlandticket nicht leisten konnten. Sicherheit: Warum ist die subjektive Sicherheit in Bus und Bahn oft entscheidender als die tatsächliche Kriminalitätsrate? Christian beschreibt, wie die Verlässlichkeit und Sauberkeit des öffentlichen Nahverkehrs entscheidend sind, um Menschen langfristig zu überzeugen. Gemeinschaftsgefühl: Öffentliche Verkehrsmittel als Orte der Begegnung? Katja berichtet von einer unerwartet erfrischenden Unterhaltung mit einem FDP-anhängenden Unternehmer im ICE – ein Beispiel, wie Mobilität auch soziale Barrieren durchbrechen kann. 2. Mobilität als Freiheit und Verantwortung Vom ländlichen Raum bis in urbane Zentren – wie können wir echte Alternativen zum Auto schaffen? Das Deutschlandticket: Christian lobt die einfache Handhabung und das demokratische Potenzial des Tickets. Katja kritisiert jedoch, dass die Finanzierung zulasten der Verkehrsunternehmen ging, die nun späte Busse streichen müssen – ein handwerklicher Fehler, der die Verkehrswende bremst. On-Demand-Lösungen: Katja schwärmt von den Möglichkeiten softwaregesteuerter Shuttles, die Flexibilität schaffen – besonders im ländlichen Raum. Doch die Politik, so kritisiert sie, lässt diese Innovation oft finanziell im Regen stehen. Der emotionale Wert des Autos: Christian beschreibt seine ambivalente Beziehung zum Auto – zwischen jugendlicher Freiheit und urbaner Einschränkung. Warum ist es so schwer, diese emotionale Bindung zu durchbrechen? 3. Das große Bild: Visionen für Mobilität Von der autogerechten Stadt bis zur Fahrrad-reparierenden Grundschule – Katja und Christian fragen: Was ist das Zielbild der Verkehrswende? Paris als Vorbild: Katja erzählt von der Bürgermeisterin Anne Hidalgo, die nicht nur Mobilität, sondern auch sozialen Wohnraum und Bildung verknüpft – und das gegen alle Widerstände. Kinder lernen hier Fahrradfahren und -reparieren im Unterricht. Hamburgs Vorstoß: Christian hebt Hamburgs Ziel hervor, dass jede*r innerhalb weniger Minuten Zugang zu öffentlicher Mobilität haben soll. Er erinnert sich, wie erschreckend voll die Straßen und Bahnhöfe oft sind, und unterstreicht, wie dringend dieser Ausbau ist. Diversität in der Planung: Warum fehlen an den Tischen der Macht oft Kinder, ältere Menschen und Menschen mit Behinderungen? Katja fordert: Mehr Perspektiven führen zu besseren Lösungen. Für Barrierefreiheit oder zum Sprachen lernen: Hier findet ihr das vollständige Transkript zur Folge: Hier gehts zum Transkript Transkription unterstützt durch AI Algorithmen von Presada (https://www.linkedin.com/company/presadaai/)…
s
she drives mobility
1 Kilian Jörg: Was ist deine Analyse für utopische Auswege aus der autodestruktiven Vernunft? 50:27
50:27  التشغيل لاحقا
التشغيل لاحقا  التشغيل لاحقا
التشغيل لاحقا  قوائم
قوائم  إعجاب
إعجاب  احب50:27
احب50:27
„Raus aus der AUTOkratie – rein in die Mobilität von morgen!“ . Schon gelesen? Wenn dir diese oder auch eine andere Folge gefällt, lass´ gern eine Bewertung da und/oder supporte mich per Ko-Fi oder PayPal . Meinen wöchentlichen Newsletter gibt es bei steady . Anfragen als Speakerin oder Panelistin an backoffice@katja-diehl.de. Die Zusammenfassung liefert euch eine KI. Macht man ja heute so. Zusammenfassung des Podcasts Im Gespräch diskutieren Katja und Kilian die ökologische Krise, die durch die gesellschaftliche Abhängigkeit vom Auto verschärft wird. Beide betonen, dass die Autonutzung nicht nur eine Gewohnheit ist, sondern kulturell und sozial tief verankert. Katja beschreibt, wie der Autokult Menschen in eine Art „Konsumfalle“ lockt, während Kilian auf den philosophischen und historischen Ursprung dieser Abhängigkeit eingeht und aufzeigt, wie sich dieser Kult in ein Konsumprodukt verwandelt hat, das die Natur zunehmend instrumentalisiert. Die beiden thematisieren die Notwendigkeit, das Verkehrs- und Mobilitätssystem zu transformieren, und beleuchten Ansätze für eine nachhaltigere, sozial gerechtere Mobilität. Hauptthesen von Katja Kritik an der Autozentrierung und sozialer Ungleichheit durch Mobilitätspolitik Katja sieht in der gesellschaftlichen Abhängigkeit vom Auto ein System der Ungleichheit, das wirtschaftlich und kulturell aufrechterhalten wird. Sie kritisiert, dass das Auto für viele Menschen ein notwendiges Übel geworden ist, weil es oftmals an alternativen Transportmitteln mangelt. Diese Abhängigkeit verstärkt soziale Ungleichheiten, indem sie Menschen ohne Zugang zu Autos benachteiligt. Katja betont, dass sozial Benachteiligte – wie zum Beispiel ältere Menschen, Menschen mit Behinderung und jene ohne finanzielle Mittel – unter dem dominanten Autoverkehrsmodell besonders leiden. Förderung eines neuen Mobilitätsparadigmas durch Bildungs- und Kulturarbeit Katja setzt auf Bildung und Kultur, um eine breite Diskussion über nachhaltige Mobilität anzustoßen. Ihr Ziel ist es, Menschen über Bücher, Kinderliteratur und Medien für alternative Verkehrsformen und eine ökologische Mobilitätswende zu sensibilisieren. Ihr Ansatz ist es, über soziale Medien und Bildungsinhalte eine Bewusstseinsveränderung anzustoßen, die auch zukünftige Generationen für umweltfreundliche und gerechtere Mobilitätslösungen begeistert. Unabhängigkeit von bestehenden Machtstrukturen durch lokale Initiativen Katja hebt die Bedeutung lokaler und regionaler Initiativen hervor, die sich von den Interessen der etablierten Auto- und Verkehrsindustrie lösen. Sie betont, dass Mobilitätswandel von unten her erfolgen sollte, durch Bürgerbewegungen und kommunale Projekte, anstatt auf politische Großreformen zu warten. Katja sieht in der lokalen Ebene die größte Kraft, um das bestehende System aufzubrechen und Alternativen wie den Ausbau öffentlicher Verkehrsmittel und Fahrradinfrastrukturen zu etablieren. Hauptthesen von Kilian Philosophische und historische Kritik an der automobilen Kultur Kilian beschreibt das Auto als Symbol für eine westliche Lebensweise, die von Isolation und Individualismus geprägt ist. Diese Kultur des Autos habe das Verhältnis zur Umwelt verändert, indem sie Menschen von der Natur entfremde und eine „fremdgesteuerte Subjektivität“ fördere. Er kritisiert, dass das Auto eine falsche Autonomie verspricht, indem es ein Gefühl der Freiheit vermittelt, das jedoch mit Abhängigkeiten und ökologischen Schäden verbunden ist. In dieser Entfremdung erkennt Kilian ein historisches Erbe, das bis ins 20. Jahrhundert zurückreicht und mit der Kolonialisierung und Industrialisierung verknüpft ist. Transformation des öffentlichen Raums und der Konsumgesellschaft Kilian betrachtet das Auto als eine künstlich erzeugte Konsumbedürfnis, das Menschen auf der Suche nach Natur und Freiheit in die Abhängigkeit von Technik und fossiler Energie drängt. Diese Abhängigkeit wird durch Werbung, Medien und die Autoindustrie ständig verstärkt. Um diese Konsumgewohnheit zu durchbrechen, plädiert Kilian für eine Umgestaltung des öffentlichen Raums, die die Dominanz des Autos in der Gesellschaft verringert und Alternativen wie den öffentlichen Nahverkehr und sichere Radwege stärkt. Vision einer gemeinschaftsorientierten, dezentralen Lebensweise Kilian schlägt vor, die automobile Kultur durch eine gemeinschaftsorientierte Lebensweise zu ersetzen, bei der Mobilität nicht als Konsumgut, sondern als Gemeinschaftsrecht begriffen wird. Er verweist auf Beispiele wie das besetzte Gelände „ZAD“ in Frankreich, wo Menschen auf Gemeinschaftsbesitz angewiesen sind und alternative Lebensstile erproben. Dies könne ein Modell für eine nachhaltige, „post-automobile“ Gesellschaft sein, in der Ressourcen geteilt und neue Mobilitätsformen etabliert werden, die weniger auf individuelle Besitzansprüche als auf kollektive Verantwortung setzen. Schlussfolgerung Katja und Kilian beleuchten im Podcast den notwendigen kulturellen Wandel, der erforderlich ist, um die ökologische Krise zu bewältigen und die gesellschaftliche Abhängigkeit vom Auto zu beenden. Während Katja einen Fokus auf Bildung, Sensibilisierung und lokale Mobilitätsinitiativen legt, fordert Kilian eine tiefergehende, philosophische und systematische Veränderung des öffentlichen Raums und der Gesellschaft hin zu einer gemeinschaftsorientierten Mobilität. Beide Ansätze ergänzen sich, indem sie sowohl die individuellen als auch die strukturellen Veränderungen ansprechen, die für eine gerechte und umweltfreundliche Mobilität notwendig sind. Kaum etwas prägt die moderne Konsumgesellschaft so sehr wie das Automobil – Grund genug, unsere toxische Liebesbeziehung zu ihm zu analysieren und Auswege aus der planetaren Autodestruktion aufzuzeigen. Jenseits von Klimabilanzen und moralischen Vorwürfen unternimmt Kilian Jörg eine letzte Spritztour durch einbetonierte Vorstellungen von »Freiheit«, »Normalität«, »Vernunft« und »Natur«, die den Ökozid als alternativlos erscheinen lassen. Mithilfe von Beyoncé, Lynch und Le Guin begibt er sich auf eine Achterbahnfahrt durch Popkultur, faschistische Männlichkeit, Erdöl, Nationalparks, aktivistische Landbesetzungen und die Tugenden der Autofetischist*innen, um zu einer Utopie autofreier Welten aufzurufen. Hier gehts zum Buch von Kilian. Für Barrierefreiheit oder zum Sprachen lernen: Hier findet ihr das vollständige Transkript zur Folge: Hier gehts zum Transkript Transkription unterstützt durch AI Algorithmen von Presada (https://www.linkedin.com/company/presadaai/)…
s
she drives mobility
1 Martin Röhrleef: Die Idee vernetzter Mobilität für Menschen statt Autos - warum fällt sie so schwer? 50:53
50:53  التشغيل لاحقا
التشغيل لاحقا  التشغيل لاحقا
التشغيل لاحقا  قوائم
قوائم  إعجاب
إعجاب  احب50:53
احب50:53
„Raus aus der AUTOkratie – rein in die Mobilität von morgen!“ . Schon gelesen? Wenn dir diese oder auch eine andere Folge gefällt, lass´ gern eine Bewertung da und/oder supporte mich per Ko-Fi oder PayPal . Meinen wöchentlichen Newsletter gibt es bei steady . Anfragen als Speakerin oder Panelistin an backoffice@katja-diehl.de. Die Zusammenfassung liefert euch eine KI. Macht man ja heute so. 🙂 Heute unterhalte ich mit Martin Röhrleef, einen ambitionierten Mobilitätsexperten mit jahrzehntelanger Erfahrung. unter anderem bei den Hannoveraner Verkehrsbetrieben üstra. Gemeinsam beleuchten wir, wie die Mobilität der Zukunft aussehen könnte – mutig, nachhaltig und menschenzentriert. Zentrale Highlights, die dich erwarten: Martins „Call-to-Action“: Was jede*r von uns tun kann, um den Wandel aktiv zu unterstützen. Ein Blick hinter die Kulissen: Welche Herausforderungen und Chancen er bei der üstra erlebt hat. Die Stadt als Lebensraum: Warum weniger Autos in Städten mehr Lebensqualität bedeuten. Technologische Innovationen: Wie neue Mobilitätsdienste wie Sharing-Angebote die Zukunft prägen können. Beraterblick: Wie Martin Städte dabei unterstützt, Mobilität für alle zugänglich und effizient zu gestalten. Katjas Plädoyer für Mut: Warum jetzt die Zeit ist, alte Strukturen aufzubrechen und Neues zu wagen. Ihre Vision einer Mobilitätswende: Warum es Zeit ist, das Auto als Standard zu hinterfragen und eine gerechtere Mobilität für alle zu schaffen. Intersektionalität als Schlüssel: Wie Mobilität Frauen, Kinder, ältere Menschen und marginalisierte Gruppen besser einbeziehen kann. Storytelling für den Wandel: Inspirierende Beispiele, wie Mobilität positive Veränderungen in Städten weltweit bewirkt hat. Persönliche Mission: Warum Katja sich Tag für Tag für eine menschenzentrierte Mobilität einsetzt. In dieser Folge des Podcasts spricht Katja Diehl, Bestsellerautorin und Vordenkerin der Mobilitätswende, mit Martin Röhrleef, einem erfahrenen Verkehrsplaner und Berater. Die beiden diskutieren zentrale Fragen der Mobilität: Warum wird das Auto oft bevorzugt? Welche Barrieren bestehen bei der Umsetzung multimodaler Verkehrskonzepte? Und was braucht es, um eine nachhaltige Mobilitätskultur zu etablieren? Röhrleef bringt tiefgehende Einblicke aus seiner Zeit bei der üstra in Hannover ein, wo er das Mobilitätspaket *HannoverMobil* entwickelte – eine visionäre Idee, die vor ihrer Zeit war. Gemeinsam beleuchten sie, warum sich innovative Konzepte oft schwer durchsetzen und was nötig ist, um Mobilität zukunftsfähig zu machen. Zentrale Themen und Erkenntnisse aus dem Gespräch **HannoverMobil: Ein visionäres Konzept** Röhrleef schildert die Entstehung des ersten Mobilitätspakets in Hannover 2004. Die Idee war revolutionär: Eine Karte bündelte Zugang zu ÖPNV, Carsharing, Mietwagen und mehr. Ziel war, eine echte Alternative zum privaten Auto zu schaffen. Doch die Umsetzung stieß auf technische und kulturelle Grenzen. **Kooperation statt Konkurrenz** Eine überraschende Erkenntnis: Auch innerhalb des öffentlichen Verkehrs gab es Widerstände gegen Kooperation. Taxiunternehmen und ÖPNV-Anbieter konkurrierten oft anstatt zu kooperieren. Röhrleef sieht darin eine verpasste Chance, Kernkompetenzen zu bündeln und kundenorientierte Lösungen zu schaffen. **Technologische Entwicklung: Chance und Hürde** Röhrleef reflektiert, wie technologische Fortschritte wie Apps und Mobilitätsplattformen heute helfen könnten, was damals noch analog und erklärungsbedürftig war. Dennoch bleibt die Integration unterschiedlicher Anbieter schwierig, da oft eine klare Geschäftsstrategie fehlt. **Kulturelle Barrieren** Das Gespräch zeigt, wie schwer es ist, Menschen von neuen Mobilitätskonzepten zu überzeugen. Routinen, Sicherheitsbedenken und die Bequemlichkeit des Autos erschweren den Umstieg. Röhrleef betont, dass ohne ein Umdenken und faire Rahmenbedingungen – etwa höhere Parkkosten – Alternativen wenig Chancen haben. **Die Zukunft der Mobilität: Vision und Realität** Röhrleef bleibt trotz der Herausforderungen optimistisch. Er sieht Potenzial in Mobilitätsbudgets für Arbeitnehmer*innen und stärker integrierten Angeboten. Entscheidend sei, dass Mobilitätslösungen echte Mehrwerte bieten, die über einfache Bündelungen hinausgehen, etwa Versicherungen oder Mobilitätsgarantien. **Intersektionalität als Mobilitätsansatz** Diehl betont, dass Mobilität nicht isoliert betrachtet werden kann. Sie plädiert für einen Ansatz, der Menschen mit unterschiedlichen Bedürfnissen – Frauen, Kinder, ältere Menschen oder Menschen mit Behinderungen – stärker einbezieht. Mobilität muss sozial gerecht und inklusiv gestaltet sein, um allen Zugang zu ermöglichen. **Lebensqualität als Argument** Eine der überraschenden Einsichten: Die Mobilitätswende wird oft auf CO₂-Einsparungen reduziert. Diehl argumentiert jedoch, dass der Fokus auf Lebensqualität, Sicherheit und Teilhabe der Bevölkerung stärker wirken könnte, um Akzeptanz und Engagement zu fördern. **Systemische Privilegien des Autos** Das Gespräch verdeutlicht, dass das Auto nicht nur durch Bequemlichkeit attraktiv bleibt, sondern vor allem durch strukturelle Vorteile: niedrige Kosten für Parkplätze, milliardenschwere Subventionen und jahrzehntelangen Ausbau autogerechter Infrastruktur. Diese Ungleichheit hemmt den Wandel hin zu alternativen Verkehrsmitteln. **Das Deutschland-Ticket als Fortschritt – mit Herausforderungen** Die Einführung des Deutschland-Tickets wird als Meilenstein begrüßt, doch die Implementierung zeigt, wie komplex die Koordination zwischen Verkehrsverbünden und Anbietern ist. Diehl sieht es als Anfang, aber nicht als Lösung für tiefere Probleme wie Zersplitterung und mangelnde Kundenorientierung. **Ein Appell für mutiges Handeln** Diehl fordert mehr Mut von Politik und Gesellschaft: Eine gleichberechtigte Mobilität erfordert unpopuläre Entscheidungen, etwa den Rückbau von Straßen und höhere Kosten für den Autoverkehr. Nur so können Alternativen attraktiv werden. Überraschende Erkenntnisse aus dem Gespräch : **Strukturelle Ungleichheiten hemmen Innovation:** Selbst visionäre Projekte wie HannoverMobil scheiterten teilweise daran, dass das System um das Auto herum aufgebaut ist. Solange diese Vorteile bestehen, bleibt es schwer, Menschen für Alternativen zu gewinnen. **Technologie allein reicht nicht:** Obwohl Apps und Plattformen den Zugang erleichtern, sind sie keine Lösung für tiefere Probleme wie fehlende Kooperation und mangelnde Kundenorientierung. **Mobilität ist nicht neutral:** Die Diskussion machte deutlich, wie sehr Mobilität soziale Gerechtigkeit, Umweltpolitik und individuelle Freiheit verbindet. Ein rein technokratischer Ansatz greift zu kurz. Warum diese Folge hörenswert ist: Dieser Podcast ist ein Muss für alle, die Mobilität aus einer ganzheitlichen Perspektive betrachten wollen. Er verbindet technologische und gesellschaftliche Einsichten mit praxisnahen Beispielen. Katja Diehl und Martin Röhrleef zeigen, dass die Mobilitätswende nicht nur eine Frage der Technik, sondern auch der Haltung und Kooperation ist. Für Barrierefreiheit oder zum Sprachen lernen: Hier findet ihr das vollständige Transkript zur Folge: Hier gehts zum Transkript Transkription unterstützt durch AI Algorithmen von Presada (https://www.linkedin.com/company/presadaai/)…
s
she drives mobility
1 Michael Dietz: Warum sollten wir mehr reisen und weniger Urlaub machen? 57:29
57:29  التشغيل لاحقا
التشغيل لاحقا  التشغيل لاحقا
التشغيل لاحقا  قوائم
قوائم  إعجاب
إعجاب  احب57:29
احب57:29
Heute tauche ich mit Michael Dietz, Reisejournalist und Co-Gründer des beliebten „ Reisen Reisen “-Podcast, in die Tiefen von Flugscham, Bahnglück, Reisen und Urlaub. Ist in einer Welt der Klimakatastrophe das Unterwegssein jenseits des Alltags noch Genuss? Und wenn ja: Wie sollte dieser gestaltet sein, um den sozialen Handabdruck größer zu machen als die ökologischen Fußabdruck? Gemeinsam werfen wir einen kritischen und positiven Blick auf die Art, wie wir reisen – und wie Reisen ein echter Beitrag zum Verständnis unserer Welt sein kann, GERADE in Zeiten der Klimakrise. „Raus aus der AUTOkratie – rein in die Mobilität von morgen!“ . Schon gelesen? Wenn dir diese oder auch eine andere Folge gefällt, lass´ gern eine Bewertung da und/oder supporte mich per Ko-Fi oder PayPal . Meinen wöchentlichen Newsletter gibt es bei steady . Die Zusammenfassung liefert euch eine KI. Macht man ja heute so. Anfragen als Speakerin oder Panelistin an backoffice@katja-diehl.de. Mit Charme und Tiefgang hinterfragt Michael Dietz die oberflächliche „Urlaubskultur“ und zeigt, wie nachhaltiges, langsames Reisen nicht nur die ökologischen Folgen mindert, sondern auch zu einem neuen, intensiven Reiseerlebnis führt. Für Dietz ist Reisen eine „Kulturtechnik“, die Austausch und echte Begegnungen möglich macht und so nicht nur die Perspektiven erweitert, sondern auch die Demokratie stärkt. Schwerpunkte: Der Unterschied zwischen Urlaub und Reisen : Dietz erklärt, warum er Reisen als „echtes Erleben“ versteht und wie es uns ermutigen kann, die Welt und andere Kulturen hautnah zu entdecken – abseits des bloßen Konsums und „Urlaubsmodus“. Er spricht darüber, wie wichtig es ist, nicht nur zu „verreisen“, sondern auch bereit zu sein, sich auf Unbekanntes einzulassen und tiefere Verbindungen zu Menschen und Orten zu knüpfen. Revenge Travel und nachhaltiges Reisen in der Klimakrise : Die Pandemie hat in vielen Menschen einen „Nachholbedarf“ geweckt, und das oft ohne Rücksicht auf die Umwelt. Doch wie lässt sich dieser Drang umwandeln in Reisen mit weniger Umweltbelastung? Dietz und Diehl diskutieren kreative Ansätze für klimafreundliches Reisen – von Nachtzügen über Fernbusse bis hin zur bewussten Wahl von Reisezielen. Nachhaltigkeit ohne erhobenen Zeigefinger : Michael Dietz zeigt, dass nachhaltiges Reisen auch Spaß machen kann, ohne belehrend zu wirken. Im Podcast „Reisen Reisen“ werden besondere Orte beschrieben und Geschichten erzählt, die inspirieren und zeigen, wie man anders reisen kann. Von Wanderungen durch europäische Landschaften bis zu abgelegenen Städten in Deutschland – Dietz betont, wie man durch die Wahl weniger bekannter Ziele nicht nur Neues erleben, sondern auch den Overtourism umgehen kann. Vom Abenteuer Nachtzug und der Freude am entschleunigten Reisen : Statt dem hektischen Hin- und Herfliegen teilt Dietz seine Begeisterung für Nachtzugfahrten, die das Reisen nicht nur nachhaltiger, sondern auch abenteuerlicher machen. Eine Nachtzugfahrt nach Wien oder eine Bahnfahrt quer durch Europa: Dietz glaubt, dass diese Art des Reisens uns bewusster erleben lässt, wie weit wir uns bewegen, und uns gleichzeitig entspannt am Ziel ankommen lässt. Tipps für den bewussten Einstieg ins Reisen : Wenn du nach Ideen suchst, wie du selbst nachhaltiger reisen kannst, gibt Dietz einfache, aber wirkungsvolle Ratschläge. Von der Buchung kleiner Gästehäuser über die Erkundung lokaler Kulturen bis hin zum bewussten Verzicht auf fest getaktete Tagespläne – er zeigt, wie Reisen zur Auseinandersetzung mit einem Ort und seinen Menschen werden kann. Das Potential von Reisen für Völkerverständigung und Demokratie : Ein weiterer wichtiger Aspekt für Dietz ist die transformative Kraft des Reisens. Wenn wir in andere Kulturen eintauchen und mit Menschen vor Ort in Kontakt kommen, wachsen Verständnis und Respekt füreinander. Dietz beschreibt dies als demokratisches Potential des Reisens: Echte Begegnungen fördern das Verständnis über Landesgrenzen hinweg. Katja Diehl und Michael Dietz führen in dieser Episode ein praxisnahes Gespräch über die Zukunft des Reisens. Schalte ein und erfahre, wie du deine eigenen Reisen anders gestalten und dabei nicht nur etwas für dich, sondern auch für die Umwelt und andere Menschen tun kannst. Für Barrierefreiheit oder zum Sprachen lernen: Hier findet ihr das vollständige Transkript zur Folge: Hier gehts zum Transkript Transkription unterstützt durch AI Algorithmen von Presada (https://www.linkedin.com/company/presadaai/)…
s
she drives mobility
1 The Serbian ‘lithium deal’: A talk about the disastrous consequences of neo-colonialism powered by german government and car manufacturers. 1:21:13
1:21:13  التشغيل لاحقا
التشغيل لاحقا  التشغيل لاحقا
التشغيل لاحقا  قوائم
قوائم  إعجاب
إعجاب  احب1:21:13
احب1:21:13
If you like this episode, put some stars on it or send it to someone who should listen to it. I make this all pro bono, but feel free to support me per Ko-Fi oder PayPal . My weekly german newsletter can be booked here steady . I work as a keynote speaker, panelist and author. Feel free to contact me! Liljana Tomoviç is a professor from the University of Belgrade with decades of experience. As her research takes place primarily in the midst of nature, she has a very deep insight into the changes that climate change is already having on the country. Aleksandar Matković is a member of the „Green-Left Front“, the main left-wing opposition party in the Serbian parliament, where he helps shape the party’s new economic policy. As a researcher he turned into a political activist with questioning the dependency of his country regarding Chinese corporates and got death threats after questioning lithium mining in Serbia. Read his Open letter regarding Rio Tinto and the “mining colony that Serbia is turning into” . In this episode of my podcast, we talk about the very specific effects that the planned mining deal, which in Germany is primarily based on the lithium requirements of car manufacturers, will have on people in Serbia, from environmental destruction to displacement. We talk about state violence, which hundreds of thousands of people in the country refuse to be intimidated by because they are afraid of a future in which their country can no longer be worth living in because it has been exploited in a neo-colonialist manner. In July of this year, Belgrade gave the green light for lithium extraction, having temporarily halted it two years previously following pressure from environmentalists. Germany needs lithium, especially in the automotive industry. Germany consumes more metal than many of its neighbouring countries, a third of which is used by the automotive industry. This means that Germany’s consumption of raw materials is far above a globally fair level. In the interview, we explain that instead of aggressively securing access to critical metals, it would be important to reduce the overall demand for raw materials, emphasises Reckordt. Above all, this would mean building smaller and fewer cars, initiating a turnaround in transport that reduces dependence on cars, recycling raw materials and drastically reducing energy consumption in industry. As a consequence, this would mean carrying out a real green transformation and actually reorganising the economy in a climate-neutral and ecological way instead of creating rebound effects and shifting environmental and human rights problems abroad. This does not go hand in hand with Germany’s self-image as a growing export and leading automotive and industrial nation. For those of you who understand German, I also recommend the previous episode that I recorded with Hannah from Powershift. Here we shed light on the almost 100 per cent metal dependency of Germany (and the German automotive industry) on neo-colonial business relationships with countries in the Global South. Serbia Protests, Mining Project, and Environmental Concerns Aleksandar discussed the escalating protests in Serbia due to changing laws allowing mining operations. He shared his involvement in internationalizing the struggle, establishing an ecological organization, and signing a declaration of international solidarity. He also mentioned receiving death threats after criticizing the economic aspects of the mine. Katja added that a protest group member was sentenced to two years in jail, further intimidating protesters. Aleksandar discussed the potential lithium mining project in Serbia, highlighting its potential environmental and social impacts. Ljiljana emphasized the importance of the region’s unique landscape for the survival of many populations in Serbia. Both agreed that the project poses a complex problem with various economic, social, and environmental risks. Environmental Protests and Lack of Official Support Ljiljana expressed her concern and sadness over the lack of official support and understanding from their country and some Western countries regarding a multi-level problem. Katja then discussed the situation in Germany, where there was a lack of awareness and action against a similar issue. Aleksandar shared his perspective on the situation in Serbia, highlighting the large-scale environmental protests that have been building up for years. He explained that the protests were not limited to one issue, but were a response to various environmental concerns, including air quality, privatization programs, and foreign direct investments. The protests gained momentum when the Rio Tinto project was realized to have significant impacts on the environment and the political landscape. Aleksandar also mentioned the use of social networks to spread information quickly. Green Colonialism and Lithium Mining Implications Aleksandar and Ljiljana discussed the international implications of the growing demand for lithium and other critical minerals. They argued that this trend, driven by multinational corporations and the German car industry, represents a form of „green colonialism“ that threatens the environment and the way of life in peripheral countries. They also highlighted the potential for widespread mining in Serbia and the Balkans, which could lead to the destruction of natural habitats and ecosystems. Ljiljana emphasized that lithium is not a sustainable solution for energy production, as it is primarily used in batteries, and that alternative solutions should be explored to ensure survival. Environmental Impact of Mining and Activism Ljiljana expresses that while most people are unaware of the environmental impact of mining, some activist groups are starting to recognize the need to reduce consumerism and transition to sustainable practices. Scientists have been warning governments about climate change for decades, but capitalist interests have impeded progress. Aleksandar recounts being labeled an „eco-terrorist“ by a pro-mining group after questioning the economic viability of a mine, facing threats, and protests arising from the harassment of activists and scientists critical of mining projects. State List Challenges and Economic Impacts Aleksandar and Katja discussed the challenges and impacts of being on a state list, which Katja described as a negative experience. Aleksandar shared his experiences of receiving mass support from public figures and intellectuals, which helped him cope with the situation. They also discussed the economic implications of the mine’s operation, with Aleksandar expressing concerns about the environmental degradation and the potential for Serbia to become a mining colony. He emphasized the need to reduce demand to avoid human rights abuses and the exploitation of nature in the peripheries. Environmental Impact of Mining and Ecosystems Katja and Ljiljana discussed the long-term effects of mining on the environment and ecosystems. Ljiljana, a biologist, explained that ecosystems take thousands of years to evolve and cannot be reversed after mining activities. She also highlighted the domino effect of mining, which could lead to the destruction of nature, water reservoirs, and agricultural fields. Ljiljana emphasized that people in power are not considering the future generations and are gambling with their destiny. She also warned about the potential for mass migrations from affected regions to economically developed countries, which could lead to a reduction in the quality of life in these countries. Ljiljana concluded by stating that they are fighting for the preservation of nature and other creatures, despite being labeled as eco-terrorists. Mining Project Challenges and Environmental Concerns Katja and Aleksandar discussed the potential profits and challenges of a mining project in Germany, highlighting the significant profits for corporations but also the social and environmental costs. They criticized the European Commission’s close ties with corporate lobbyists and the potential for unequal treatment among nations. They also discussed the need for diversification of materials, a reduction in demand, and better public transport in Germany. Ljiljana shared her concerns about the impact of human activities on nature and populations, and the issue of corruption in preserving natural habitats. She also mentioned the solidarity among activist organizations from different regions facing similar problems with lithium and other mines. The group agreed on the importance of international cooperation and solidarity in their respective fights. Addressing Disconnects and Advocating for Change Ljiljana expressed concerns about the disconnect between environmental ideals and realities faced by communities impacted by issues like mining. Katja agreed, emphasizing the importance of connecting with others beyond individual actions. They discussed the interconnectedness of economy and ecology, with Ljiljana stressing these aspects should not be separated. Katja shared her desire to help people speak out against injustice. Ljiljana provided observations on current affairs in Serbia and the Balkans, comparing them to China and Russia. They highlighted the role of information and media in shaping public opinion. Katja mentioned her advocacy work amplifying people’s stories. The conversation ended with Katja offering to share a podcast link featuring Carola Rackete and the left party. Für Barrierefreiheit, zum Sprachen lernen oder einfach zum mitlesen: Hier findet ihr das vollständige Transkript zur Folge: Hier gehts zum Transkript auf Deutsch Hier gehts zum Transkript auf Englisch Transkription unterstützt durch AI Algorithmen von Presada (https://www.linkedin.com/company/presadaai/)…
s
she drives mobility
1 Rohstoffe am Wendepunkt? Deutschlands Abhängigkeit und die Zukunft der Versorgungssicherheit. 49:14
49:14  التشغيل لاحقا
التشغيل لاحقا  التشغيل لاحقا
التشغيل لاحقا  قوائم
قوائم  إعجاب
إعجاب  احب49:14
احب49:14
In dieser Podcast-Folge tauche ich mit Hannah Pilgrim, Expertin der Berliner NGO PowerShift , tief in die Welt der kritischen Rohstoffe ein. Wir beleuchten Deutschlands Abhängigkeit von metallischen Rohstoffen und die Herausforderungen, die damit einhergehen. Gemeinsam diskutieren wir, warum unser modernes Leben ohne diese Materialien kaum denkbar wäre – von Autos bis zu Smartphones – und wie gefährlich unsere Importabhängigkeit werden kann. Die Folge bietet Einsichten in aktuelle europäische Gesetze, die Intransparenz, die deren Ausführung begleitet und sensibilisiert für die sozialen und ökologischen Konsequenzen unseres Rohstoffhungers. „Raus aus der AUTOkratie – rein in die Mobilität von morgen!“ . Schon gelesen? Wenn dir diese oder auch eine andere Folge gefällt, lass´ gern eine Bewertung da und/oder supporte mich per Ko-Fi oder PayPal . Meinen wöchentlichen Newsletter gibt es bei steady . Die Zusammenfassung liefert euch eine KI. Macht man ja heute so. Anfragen als Speakerin oder Panelistin an backoffice@katja-diehl.de. Schwerpunkte dieser Episode: Deutschlands starke Abhängigkeit von Rohstoffimporten Wusstet ihr, dass Deutschland, obwohl wir als „Exportweltmeisterin“ gelten, fast alle seine metallischen Rohstoffe importiert? In dieser Folge erklärt Hannah, warum es in Deutschland keinen aktiven Metallabbau mehr gibt und wie diese Abhängigkeit von Ländern wie Brasilien, Südafrika und Peru Deutschland verwundbar macht. Diese Tatsache, gepaart mit Deutschlands hohem Rohstoffverbrauch, birgt nicht nur wirtschaftliche Risiken, sondern auch moralische Fragen zu fairen Handelspraktiken. Warum das wichtig ist: Ohne die nötigen Rohstoffe würde die deutsche Industrie – von der Automobilbranche bis zur Bauwirtschaft – stillstehen. Der Podcast zeigt, wie brisant die Abhängigkeit ist und welche Gefahren sie birgt. Das europäische „Critical Raw Materials Act“ (CRMA) Das neue EU-Gesetz zur Sicherung kritischer Rohstoffe sorgt für Bewegung: Ziel ist es, Europas Abhängigkeit von Importen zu verringern und mehr Rohstoffe lokal zu fördern und zu recyceln. Klingt nach einem Schritt in die richtige Richtung? Hannah erläutert, warum das Gesetz nicht nur Vorteile bringt. Besonders die Intransparenz bei der Auswahl strategischer Projekte und die möglichen negativen Folgen für rohstoffreiche Länder außerhalb Europas werfen Fragen auf. Steht die EU damit vor einer neuen Form des Kolonialismus? Warum das wichtig ist: Der CRMA wird in den kommenden Jahren die Rohstoffpolitik der EU prägen und hat das Potenzial, den globalen Rohstoffmarkt drastisch zu verändern – mit weitreichenden Auswirkungen auf Umwelt und Gesellschaft. Umweltschäden und soziale Ungerechtigkeiten durch den Rohstoffabbau Der Podcast beleuchtet die oft unsichtbaren Folgen der Rohstoffgewinnung: indigene Gemeinschaften verlieren ihre Lebensgrundlagen, und Umweltzerstörung schreitet unaufhaltsam voran. Besonders problematisch ist, dass die meisten dieser Länder von der Wertschöpfung – also der Weiterverarbeitung der Rohstoffe – nicht profitieren. Während Europa und Deutschland den Rohstoffverbrauch weiter ankurbeln, zahlen andere die Kosten. Ein Beispiel: Elektroautos gelten als nachhaltig, doch ihre Batterien bestehen aus ressourcenintensiven Metallen, was den vermeintlichen Umweltvorteil dann relativiert, wenn der Bau dieses Autos auf die Statistik trifft, dass Pkw in Deutschland sind nur 45 Minuten am Tag bewegen und immer größer werden. Warum das wichtig ist: Unsere Entscheidungen beim Konsum und in der Politik haben direkte Auswirkungen auf Menschen und Umwelt in anderen Teilen der Welt. Wir sensibilisieren für die globalen Verflechtungen und wollen, dass wir alle daraufhin bewusster handeln. Neben den drei zentralen Punkten beleuchtet die Folge auch weitere wichtige Themen, die oft im Alltag übersehen werden. So z. B., dass sich viele Menschen – vor allem im Hinblick auf Autos – selten bewusst machen, dass diese ohne den Einsatz von Rohstoffen aus außereuropäischen Ländern kaum gebaut könnten. Metalle wie Kupfer, Nickel und Aluminium, die für den Bau von Autos unverzichtbar sind, stammen größtenteils aus Ländern des globalen Südens. Diese Rohstoffe ermöglichen nicht nur die Produktion von Fahrzeugen, sondern auch von Elektronik, Smartphones und vielen Alltagsgegenständen. Darüber hinaus diskutieren wir, das der Rohstoffabbau in diesen Ländern oft unter schwierigen Bedingungen erfolgt und wie das Ungleichgewicht zwischen Wertschöpfung und Belastung weiterhin besteht: Während Europa und Deutschland von der Verarbeitung und Nutzung dieser Rohstoffe profitieren, tragen die exportierenden Länder die ökologischen und sozialen Kosten. Auch die Automobilindustrie steht vor der Herausforderung, nachhaltigere und gerechtere Lösungen zu finden, um die massiven Ressourcenbedarfe zu reduzieren. Warum diese Folge anhören? Diese Podcast-Folge ist ein Muss für alle, die wissen wollen, wie unser Alltag mit den globalen Rohstofflieferketten verknüpft ist – und warum es höchste Zeit ist, das Thema Rohstoffe neu zu denken.…
s
she drives mobility
1 Verfassungsbeschwerde: Friedliche Klimaproteste vor Gericht – Ist unser Recht fit für eine Welt in der Klimakatastrophe? 57:24
57:24  التشغيل لاحقا
التشغيل لاحقا  التشغيل لاحقا
التشغيل لاحقا  قوائم
قوائم  إعجاب
إعجاب  احب57:24
احب57:24
„Raus aus der AUTOkratie – rein in die Mobilität von morgen!“ . Schon gelesen? Wenn dir diese oder auch eine andere Folge gefällt, lass´ gern eine Bewertung da und/oder supporte mich per Ko-Fi oder PayPal . Meinen wöchentlichen Newsletter gibt es bei steady . Die Zusammenfassung liefert euch eine KI. Macht man ja heute so. 🙂 Meine aktuellen Lesungen und Vorträge findet ihr immer hier . In dieser Episode geht es um die rechtlichen Konsequenzen des Klimaaktivismus, insbesondere um die Protestaktionen der Letzten Generation. Aktivist*innen, die mit Straßenblockaden und anderen Aktionen auf den Klimanotstand aufmerksam machen, sehen sich zunehmend mit harten juristischen Maßnahmen konfrontiert. In diesem Gespräch diskutieren wir mit Irma, einer Aktivistin der letzten Generation, sowie Ronen Steinke, Journalist und Jurist, und Stephan Bsdurek, einem Rechtsreferendar und Mitglied des RAZ e.V., über die Eskalation der Strafverfolgung und die damit verbundenen Herausforderungen. Schwerpunkte: Protestformen der Letzten Generation : Straßenblockaden als friedlicher Protest gegen die Untätigkeit in der Klimapolitik. Persönliche Erfahrungen im Strafverfahren : Irma berichtet von ihren Aktionen, dem Gerichtsprozess und der Verurteilung zu Tagessätzen wegen Nötigung und Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte. Zunehmende Härte der Urteile : Die Strafmaßverschärfung bei wiederholten Protestaktionen, von Geldstrafen bis hin zu Freiheitsstrafen. Rechtsstaatliche Grauzonen : Anwendung und Kritik am „Gummiparagrafen“ der Nötigung (§240 StGB) und die Verwerflichkeitsprüfung. Rolle des RAZ e.V. : Der Verein bietet juristische und psychologische Unterstützung für Aktivist*innen, die sich vor Gericht verantworten müssen. Strategische Verfassungsbeschwerde : Irma und ihr Anwaltsteam haben eine Verfassungsbeschwerde eingereicht, um grundsätzliche Fragen zur Legitimität des Protestes und zur Handhabung des Gesetzes zu klären. Gesellschaftliche und rechtliche Entwicklungen : Ronen Steinke erklärt, wie Gerichte und der Staat zunehmend härter gegen Klimaaktivist*innen vorgehen und welche politischen Motivationen dahinterstehen. Zusammenfassung: In dieser Podcastfolge stehen die rechtlichen Auseinandersetzungen rund um die Proteste der Letzten Generation im Mittelpunkt. Irma, eine Aktivistin, teilt ihre persönliche Erfahrung, nachdem sie an Straßenblockaden teilgenommen hat und in einem langwierigen Gerichtsprozess wegen Nötigung und Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte verurteilt wurde. Sie erklärt, warum sie sich trotz juristischer Risiken weiterhin für den Klimaschutz einsetzt und wie wichtig es ist, friedlichen Protest in einer Demokratie zu ermöglichen. Ronen Steinke analysiert die zunehmende Härte der deutschen Gerichte im Umgang mit Klimaaktivist*innen. Er beschreibt, wie anfängliche mildere Urteile sich in den letzten Jahren in teils drastische Strafen verwandelt haben, bis hin zu Freiheitsstrafen für wiederholte Protestaktionen. Dabei geht es vor allem um die Anwendung des Nötigungsparagrafen (§240 StGB), der in vielen Fällen eine strafrechtliche Verurteilung ermöglicht, obwohl der Protest friedlich und gewaltfrei bleibt. Stephan Bsdurek, Rechtsreferendar und Teil des RAZ e.V., erläutert die Unterstützung, die der Verein Aktivist*innen bietet. Neben rechtlicher Beratung und Prozessbegleitung hilft der RAZ e.V. auch bei der emotionalen Bewältigung der Ängste, die mit Gerichtsverfahren und der Möglichkeit einer Haftstrafe verbunden sind. Die Proteste der letzten Generation seien Teil eines breiteren demokratischen Engagements, das durch rechtliche Repression nicht geschwächt werden dürfe. Ein besonderer Fokus liegt auf Irmas Verfassungsbeschwerde, die sie nach mehreren Gerichtsinstanzen eingelegt hat. Ziel ist es, das Bundesverfassungsgericht dazu zu bringen, eine grundsätzliche Entscheidung über die Legitimität von Klima-Protesten zu treffen und den rechtlichen Rahmen zu klären. Dabei geht es um die Frage, ob friedlicher Protest gegen die Klimakrise tatsächlich als strafbare Handlung geahndet werden darf, und welche Rolle der Schutz zukünftiger Generationen in der Rechtsprechung spielen sollte. Diese Episode wirft nicht nur einen Blick auf die persönlichen Erfahrungen der Aktivist*innen, sondern auch auf die juristischen und gesellschaftlichen Entwicklungen in Deutschland. Für Barrierefreiheit oder zum Sprachen lernen: Hier findet ihr das vollständige Transkript zur Folge: Hier gehts zum Transkript Transkription unterstützt durch AI Algorithmen von Presada (https://www.linkedin.com/company/presadaai/)…
s
she drives mobility
1 Claudia Kemfert, Manuel, Julien: "Unlearn CO2" - geht das überhaupt? 54:36
54:36  التشغيل لاحقا
التشغيل لاحقا  التشغيل لاحقا
التشغيل لاحقا  قوائم
قوائم  إعجاب
إعجاب  احب54:36
احب54:36
„Raus aus der AUTOkratie – rein in die Mobilität von morgen!“ . Schon gelesen? Wenn dir diese oder auch eine andere Folge gefällt, lass´ gern eine Bewertung da und/oder supporte mich per Ko-Fi oder PayPal . Meinen wöchentlichen Newsletter gibt es bei steady . Die Zusammenfassung liefert euch eine KI. Macht man ja heute so 🙂 In dieser Episode von „She Drives Mobility“ spricht Katja Diehl mit den Gästen Julien und Manuel von der Treibhauspost über das Buchprojekt „Unlearn CO₂“ , das sie gemeinsam mit der renommierten Wissenschaftlerin Claudia Kemfert realisiert haben. Das Buch bietet 14 Beiträge von 17 Autor*innen und beleuchtet die Klimakrise aus verschiedenen Perspektiven wie Ernährung , Mobilität , Patriarchat , Ableismus und Recht . Kernpunkte der Episode: Interdisziplinäre Ansätze zur Klimakrise: Die Gäste betonen, dass die Klimakrise in allen gesellschaftlichen Bereichen spürbar ist. Von Ernährung über Mode bis hin zu Medien und Recht – das Buch zeigt auf, wie tiefgreifend der Wandel sein muss, um eine klimagerechte Zukunft zu ermöglichen. Klimakrise und soziale Gerechtigkeit: Die Autor*innen diskutieren, wie unterschiedliche Bevölkerungsgruppen unterschiedlich von der Klimakrise betroffen sind. Besonders Frauen , Menschen im globalen Süden und Menschen mit Behinderungen leiden unter den Folgen der Krise. Es wird betont, dass Klimaschutz eine Frage der Gerechtigkeit ist. Banden bilden für den Wandel: Katja und ihre Gäste sprechen darüber, wie wichtig es ist, Gemeinschaften zu bilden, die sich für den Klimaschutz engagieren. Dabei steht die Idee im Vordergrund, dass man auch mit Unterschieden zusammenarbeiten kann, ohne Perfektion zu fordern. Recht als Hebel für den Klimaschutz: Ein besonderes Kapitel im Buch befasst sich mit der Frage, wie das Rechtssystem genutzt werden kann, um den Klimaschutz voranzutreiben. Klimaklagen wie jene gegen Volkswagen zeigen, dass juristische Mittel starke Werkzeuge im Kampf gegen die Klimakrise sein können. Ableismus und Inklusion im Klimadiskurs: Im Gespräch wird deutlich, dass der Klimadiskurs oft behindertenfeindlich ist. Menschen mit Behinderungen sind nicht nur besonders von den Folgen der Klimakrise betroffen, sondern werden oft von Lösungen ausgeschlossen. Hier setzen die Autoren an, um das Thema Inklusion in den Fokus zu rücken. Weitere Themen: Die Episode geht darüber hinaus auf die Notwendigkeit ein, wie die Medien über die Klimakrise berichten sollten, und thematisiert, wie häufig die Klimakrise in deutschen Talkshows vernachlässigt wird. Die Gäste betonen, dass die gesellschaftliche Diskussion über den Klimawandel intensiviert werden muss. Katja Diehl gibt außerdem Einblicke in ihren eigenen Beitrag zum Buch, in dem sie die Verkehrspolitik als Schlüssel zur CO₂-Reduktion anspricht und die Notwendigkeit einer Mobilitätswende ohne Autos erläutert. Fazit: Diese Folge bietet tiefgehende Einblicke in das Buch „Unlearn CO₂“ und zeigt, wie interdisziplinär die Lösung der Klimakrise angegangen werden muss. Die Gäste regen dazu an, den Wandel nicht nur zu erhoffen, sondern aktiv zu gestalten und sich für eine klimagerechte Zukunft zu engagieren. Für Barrierefreiheit oder zum Sprachen lernen: Hier findet ihr das vollständige Transkript zur Folge: Hier gehts zum Transkript Transkription unterstützt durch AI Algorithmen von Presada (https://www.linkedin.com/company/presadaai/)…
s
she drives mobility
1 Christoph Störmer: Warum klagt ihr erneut für das Klima und eine gute Zukunft für alle? 35:29
35:29  التشغيل لاحقا
التشغيل لاحقا  التشغيل لاحقا
التشغيل لاحقا  قوائم
قوائم  إعجاب
إعجاب  احب35:29
احب35:29
„Raus aus der AUTOkratie – rein in die Mobilität von morgen!“ . Schon gelesen? Wenn dir diese oder auch eine andere Folge gefällt, lass´ gern eine Bewertung da und/oder supporte mich per Ko-Fi oder PayPal . Meinen wöchentlichen Newsletter gibt es bei steady . Die Zusammenfassung liefert euch eine KI. 😉 Verfassungsklagen als Mittel zum Klimaschutz Ambitions- und Umsetzungslücke in der deutschen Klimapolitik Kritik an der aktuellen Ampelkoalition Bedeutung rechtlicher Schritte für den Klimaschutz Erläuterung der Schwerpunkte: Verfassungsklagen als Mittel zum Klimaschutz: Die Deutsche Umwelthilfe hat zusammen mit anderen Organisationen Verfassungsklagen eingereicht, um die Bundesregierung dazu zu zwingen, ihre Klimaziele ernst zu nehmen. Diese Klagen basieren auf der Argumentation, dass das aktuelle Klimaschutzgesetz die Lebensgrundlagen zukünftiger Generationen gefährdet und daher verfassungswidrig ist. Durch diese rechtlichen Maßnahmen sollen die bestehenden Gesetze nachgebessert und an die notwendigen Klimaziele angepasst werden. Ambitions- und Umsetzungslücke in der deutschen Klimapolitik: Christoph Stürmer erläutert, dass die deutsche Klimapolitik zwei wesentliche Defizite aufweist. Die „Ambitionslücke“ bezieht sich darauf, dass die derzeit festgelegten Klimaziele nicht ausreichen, um die erforderlichen Emissionsreduktionen zu erreichen. Zusätzlich gibt es eine „Umsetzungslücke“, da selbst diese unzureichenden Ziele in der Praxis nicht konsequent verfolgt werden. Diese Lücken gefährden die Einhaltung internationaler Klimaziele und den Schutz zukünftiger Generationen. Kritik an der aktuellen Ampelkoalition: Im Gespräch wird die Verantwortung der derzeitigen Bundesregierung, insbesondere der Ampelkoalition, betont. Diehl und Stürmer kritisieren, dass die Regierung wichtige Maßnahmen, wie beispielsweise ein Tempolimit auf Autobahnen, bisher nicht umgesetzt hat, obwohl sie für den Klimaschutz dringend erforderlich wären. Diese Untätigkeit wird als Zeichen dafür gesehen, dass die Regierung ihre Klimaziele nicht ernst genug nimmt. Bedeutung rechtlicher Schritte für den Klimaschutz: Die rechtlichen Schritte, die die Deutsche Umwelthilfe unternimmt, werden als notwendiges Mittel gesehen, um die Regierung zur Verantwortung zu ziehen und den Klimaschutz in Deutschland voranzutreiben. Da politische Maßnahmen oft nicht ausreichen oder zu langsam umgesetzt werden, sind gerichtliche Klagen ein effektives Instrument, um die Einhaltung von Klimazielen sicherzustellen und rechtliche Klarheit zu schaffen. Fazit: Unser Gespräch verdeutlicht, dass Deutschland im Bereich Klimaschutz erheblichen Nachholbedarf hat. Die eingereichten Verfassungsklagen zeigen, wie ernst die Lage ist und dass es ohne rechtlichen Druck kaum Fortschritte geben wird. Die Ambitions- und Umsetzungslücken der aktuellen Klimapolitik, gepaart mit der unzureichenden Reaktion der Regierung, machen deutlich, dass es dringend stärkerer und konsequenterer Maßnahmen bedarf. Rechtliche Schritte spielen hierbei eine zentrale Rolle, um die notwendigen Veränderungen im Klimaschutz durchzusetzen und die Rechte zukünftiger Generationen zu wahren. Für Barrierefreiheit oder zum Sprachen lernen: Hier findet ihr das vollständige Transkript zur Folge: Hier gehts zum Transkript Transkription unterstützt durch AI Algorithmen von Presada (https://www.linkedin.com/company/presadaai/)…
s
she drives mobility
1 Ingrid Brodnig: Das mit den Fakten kommt nicht "durch", was tun in Zeiten der verrohten Debatten? 1:04:48
1:04:48  التشغيل لاحقا
التشغيل لاحقا  التشغيل لاحقا
التشغيل لاحقا  قوائم
قوائم  إعجاب
إعجاب  احب1:04:48
احب1:04:48
Die Arbeit von Ingrid verfolge ich schon lange, auch, weil sie immer wieder damit hilft, einzusortieren, warum trotz allem Faktenwissens um die Klimakatastrophe die Transformation so stagniert – vor allem auch in der Mobilitätswende. Diese Betrachtung ist auch zentraler Teil meines neuen Buches „Raus aus der AUTOkratie – rein in die Mobilität von morgen!“ . Schon gelesen? Wenn dir diese oder auch eine andere Folge gefällt, lass´ gern eine Bewertung da und/oder supporte mich per Ko-Fi oder PayPal . Meinen wöchentlichen Newsletter gibt es bei steady . Wir diskutieren die Herausforderungen politischer Debatten, die Gefahren von Gruppenzugehörigkeitsgefühlen und die Bedeutung von Empathie und Selbstkritik. Was sind erfolgreiche Strategien für effektive Kommunikation, welche Rolle spielt der Journalismus bei der Polarisierung und der Notwendigkeit, das Vertrauen in staatliche Institutionen zu stärken. Gruppenzugehörigkeitsgefühle und politische Debatten Ingrid betont, wie schnell sich Menschen in Gruppen einordnen und wie dies zu Feindseligkeit führen kann, insbesondere wenn eine Bedrohung durch andere wahrgenommen wird. Für sie wird dadurch der gesellschaftliche Konsens verunmöglicht, der besonders bei Themen wie dem Klimawandel Basis sein sollte. Identität und zwischenmenschliche Interaktionen Das Gute an der Arbeit von Ingrid? Sie hat auch immer Lösungsansätze, wie scheinbar unüberbrückbare Differenzen überwunden werden können. So betonte sie die Wirksamkeit, im persönlichen Gespräch nach Gemeinsamkeiten zu suchen: Der Fußballverein, das Hobby, die Kinder. Verschiedene Facetten der Identität anzusprechen, kann festgefahrene Meinungen auflockern und negative Einstellungen verringern. Auch sei es wichtig, Selbstreflexion zu betreiben und das Zurücktreten zu üben, wenn man in starke Gefühle verwickelt wird. Denn gerade Wut ist ein Tool, dass die Status Bewahrer*innen gut für sich zu nutzen wissen. Ingrid zeigt auf, wie wichtig es ist, immer auch Empathie und Achtsamkeit zu zeigen, um eine gemeinsame Basis zu finden und die andere Person zu erreichen. Denn genau DAS macht die „Gegenseite“ nicht. Laut Ingrid bewies eine Studie der Universität Stanford die Wirksamkeit von Empathie bei der Überzeugung von anderen Facetten von einer Debatte. Dabei sei es wichtig, sich nicht auf die eigene Position zu konzentrieren, sondern auch die Perspektive des Gegenübers zu berücksichtigen, um eine produktive und respektvolle Diskussion zu ermöglichen. Ingrid beleuchtet dabei auch die Gefühle der Unsicherheit und des Verlusts, die entstehen, wenn von einer (falschen) festen Meinung abgerückt werden soll. Ich warf noch hinein, dass viele privilegiert sind, diese sich aber nicht so betrachten (wollen) – und das Debatten auch erschwert. Weil hier der Verlust systemisch natürlich vorhanden ist: Privilegien wieder in die Gemeinschaft geben, schmerzt – hilft aber allen (siehe Parkplatzrückgabe :))) – Ingrid hob auch hier die Tendenz hervor, dass Emotionen anstelle von Fakten in Diskussionen helfen, und verwies dabei auf die Debatte über Mobilität und Klimawandel. Sie erwähnte auch eine Studie des Potsdamer Instituts für Klimafolgenforschung, die vorhersagt, dass Deutschland aufgrund der aktuellen Treibhausgasproduktion einen Gehaltsverlust von 11% erleben könnte. Strategien für effektive Kommunikation in Debatten . Ingrid betonte die Wichtigkeit, Emotionen zu berücksichtigen und die Fakten noch vorne zu stellen, anstatt Falschinformationen zu wiederholen. Sie empfiehlt das „Sandwich-Prinzip“ und die Selbstvergewisserung vor Debatten. Ich habe mit Ingrid auch über meine steigende „Faktenmüdigkeit“ gesprochen. Es gibt einfach kein Erkenntnisproblem, dennoch erscheinen immer noch Bücher, die die Fakten betonen – emotional aber nicht bewegen. Und nur Emotionen bewegen, Fakten berühren Menschen nicht. Ingrid empfielt daher, Geschichten zu erzählen statt nur Fakten zu präsentieren. Medienpopulismus und Hassrede: Eine Analyse des Rechtssystems Als nächstes diskutierten wird die Rolle des Journalismus bei der Verstärkung von Polarisierung und populistischen Trends in den Medien. Ingrid erklärte das Konzept des „Medienpopulismus“, bei dem Medien in ihrer Berichterstattung ähnliche Rhetorik wie Populist*innen verwenden. Wir sprachen auch über die Herausforderungen des Rechtssystems bei der Bewältigung von Hassrede und meinen persönlichen Erfahrungen damit – seit Jahren. Der mangelnde Opferschutz und die Bagatellisierung von Hatespeech in der Gesellschaft droht, die Vielfalt der Stimmen zu begrenzen und gefährdet unsere Demokratie. Ingrid hob die Notwendigkeit hervor, das Vertrauen in staatliche Institutionen zu stärken und den Schutz vor Online-Hass zu verbessern. Für sie ist es unerlässlich, dass Betroffene Vorfälle immer und immer wieder veröffentlichen, damit Nichtbetroffene die Brisanz dieser Bedrohung begreifen. Fazit: Was wäre notwendig: Entwicklung von Strategien zur Verringerung von Medienpopulismus und polarisierenden Debatten in der Berichterstattung. Aufklärungsarbeit über die Auswirkungen von Hassrede und Bedrohungen auf marginalisierte Stimmen in der Öffentlichkeit. Medien: Schulung im Umgang mit sensiblen Themen und Bedrohungssituationen von Interviewpartner*innen. Rechtssystem: Überprüfung und Anpassung der Gesetze zur effektiveren Verfolgung von Hassrede und Bedrohungen im digitalen Raum. Förderung von Empathie und konstruktivem Dialog in öffentlichen Debatten, insbesondere bei kontroversen Themen wie Klimawandel und Mobilitätswende. Für Barrierefreiheit oder zum Sprachen lernen: Hier findet ihr das vollständige Transkript zur Folge: Hier gehts zum Transkript Transkription unterstützt durch AI Algorithmen von Presada (https://www.linkedin.com/company/presadaai/)…
s
she drives mobility
1 Maren Urner und Jens Foell: Wie schaffen wir radikale Transformation und welche Rolle spielen dabei unsere Emotionen? 57:28
57:28  التشغيل لاحقا
التشغيل لاحقا  التشغيل لاحقا
التشغيل لاحقا  قوائم
قوائم  إعجاب
إعجاب  احب57:28
احب57:28
Maren Urner ist nicht nur Gästin meines Podcasts, sondern auch Teil meines neuen Buches „Raus aus der AUTOkratie – rein in die Mobilität von morgen!“ . Jens Foell ist Neuropsychologe, Redakteur und Autor und kam von Florida zurück nach Deutschland, als im angeboten wurde, Teil des maiLab-Teams zu werden. Auch im Nachfolgeformat MaiThink X im ZDFneo ist er zu sehen. Wenn dir diese oder auch eine andere Folge gefällt, lass´ gern eine Bewertung da und/oder supporte mich per Ko-Fi oder PayPal . Meinen wöchentlichen Newsletter gibt es bei steady . In dieser Episode tauchen wir tief in die Themen der radikalen Ehrlichkeit und emotionalen Intelligenz ein. Wir widmen uns dabei im Schwerpunkt drei Begriffen: Radikal, Emotion und Aktivismus – alles drei Begriffe, die mal positiv gelesen wurden und heute eher abwertend genutzt werden. Warum eigenlich? Dazu bringen Maren und Jens ihre unterschiedlichen Hintergründe und Perspektiven zusammen, um über die Herausforderungen und Möglichkeiten in der Wissenschaftskommunikation und politischen Veränderung zu sprechen. Gäste, vorgestellt von ChatGPT, dem ich das Transkript zu lesen gab: Maren Urner: Eine Wissenschaftlerin, die sich mit der Funktionsweise des Gehirns und den emotionalen Prozessen dahinter auseinandersetzt. Sie erklärt, wie Emotionen unser Verständnis und unsere Wahrnehmung von Begriffen wie „radikal“ beeinflussen. Jens Foell: Ein Wissenschaftskommunikator, der aus der psychologischen Forschung stammt und sich dafür einsetzt, wissenschaftliche Erkenntnisse verständlich und zugänglich zu machen. Er beleuchtet die Schwierigkeiten und Notwendigkeiten, komplexe wissenschaftliche Themen für ein breiteres Publikum aufzubereiten. Themen der Episode: Radikalität neu definiert : Was bedeutet „radikal“ wirklich? Ursprünglich aus dem Lateinischen stammend, bedeutet es „an die Wurzel gehen“. Wir diskutieren, wie dieser Begriff im öffentlichen Diskurs oft missverstanden und negativ konnotiert wird. Maren erläutert, wie das Gehirn auf wiederholte negative Assoziationen reagiert und warum wir oft zögern, uns selbst als radikal zu bezeichnen, selbst wenn wir tiefgreifende Veränderungen anstreben. Die „Wissenschaftsbubble“ und ihre Herausforderungen : Jens teilt seine Erfahrungen aus der Wissenschaftskommunikation und erklärt, wie schwierig es sein kann, wissenschaftliche Inhalte so zu vermitteln, dass sie von einem breiten Publikum verstanden werden. Er spricht über die Notwendigkeit, wissenschaftliche Begriffe und Konzepte zu erklären, die innerhalb der akademischen Gemeinschaft oft als selbstverständlich vorausgesetzt werden. Die Bedeutung von Public Engagement und die Unterschiede in der wissenschaftlichen Ausbildung zwischen Deutschland und Großbritannien werden hervorgehoben. Maren beschreibt, wie sie in Großbritannien lernte, Wissenschaft nicht nur innerhalb der akademischen Welt zu kommunizieren, sondern auch mit der allgemeinen Öffentlichkeit in Dialog zu treten. Emotionen in der Politik und Wissenschaft : Wir diskutieren, wie Emotionen eine zentrale Rolle in unserem politischen und wissenschaftlichen Handeln spielen. Maren betont, dass alle unsere Entscheidungen, auch die scheinbar rationalen, immer von emotionalen Prozessen beeinflusst werden. Die Herausforderungen und Chancen, die sich ergeben, wenn man Emotionen in die Wissenschaftskommunikation integriert, werden thematisiert. Maren spricht über ihr Buchprojekt, das sich mit den Emotionen in der Politik auseinandersetzt und erklärt, warum sie es für wichtig hält, emotionale Intelligenz und Wissenschaft zu verbinden. Persönliche Geschichten und Anekdoten : Jens und Maren teilen persönliche Geschichten und Erlebnisse aus ihrer Karriere und wie diese sie dazu gebracht haben, sich für eine verständlichere und inklusivere Wissenschaftskommunikation einzusetzen. Die Episode schließt mit unserem Aufruf, sich der eigenen Radikalität zu stellen und die emotionale Dimension unseres Handelns anzuerkennen. Fazit von ChatGPT: Diese Episode bietet einen tiefen Einblick in die Schnittstelle von Wissenschaft, Emotionen und radikaler Ehrlichkeit. Sie fordert uns heraus, unsere eigenen Vorurteile zu hinterfragen und ermutigt uns, die transformative Kraft von Emotionen in unserem Streben nach Veränderung zu nutzen. Spannend für alle, die an den Themen Wissenschaftskommunikation, politische Transformation und emotionale Intelligenz interessiert sind. Für Barrierefreiheit oder zum Sprachen lernen: Hier findet ihr das vollständige Transkript zur Folge: Hier gehts zum Transkript Transkription unterstützt durch AI Algorithmen von Presada (https://www.linkedin.com/company/presadaai/)…
s
she drives mobility
1 Endlich beschlossen - und nun? Was bedeuten die Novellen des Straßenverkehrsgesetzes, der StVO und das Urteil gegen Gehwegparken in Bremen? 43:43
43:43  التشغيل لاحقا
التشغيل لاحقا  التشغيل لاحقا
التشغيل لاحقا  قوائم
قوائم  إعجاب
إعجاب  احب43:43
احب43:43
Danke an alle, die mein Buch „Raus aus der AUTOkratie – rein in die Mobilität von morgen!“ vorbestellt haben. WIR haben es tatsächlich erneut geschafft: Top 10 der SPIEGEL-Bestsellerliste. Mein Buch kam direkt auf Platz 8. DANKE! Wenn dir diese oder auch eine andere Folge gefällt, lass´ gern eine Bewertung da und/oder supporte mich per Ko-Fi oder PayPal . Meinen wöchentlichen Newsletter gibt es bei steady . Natürlich musste ich nach den guten Neuigkeiten aus Berlin, dass endlich auf Basis der Novellierung des Straßengesetzes auch die Straßenverkehrsordnung ein Update erhält, mich nach Gesprächspartnerinnen umschauen, um dies direkt einordnen zu können. Meine Gästinnen: Swantje Michaelsen, für die Grünen im Bundesttag, auch auch „darüber hinaus eine starke Stimme für eine feministische Verkehrspolitik, die alle Menschen im Blick hat. Ich mache mich stark für eine Gesellschaft, die auf echte Gleichberechtigung setzt.“ Ihre Einordnung: Im Straßenverkehrsgesetz (StVG) werden Klima- und Umweltschutz, Gesundheit und städtebauliche Entwicklung als neue Hauptziele neben der Sicherheit und Leichtigkeit verankert, wobei die Sicherheit besonders priorisiert wird. Das Ergebnis des Vermittlungsausschusses muss am Freitag noch durch Bundestag und Bundesrat beschlossen werden. Damit die Kommunen die neuen Spielräume des Straßenverkehrsgesetzes (StVG) anwenden können, müssen sie in der Straßenverkehrsordnung (StVO) umgesetzt werden. Ein Entwurf für die StVO liegt bereits vor. Neben dem Abbau von Hürden für Fußwege, Radwege und Busspuren erhalten die Kommunen auch bei Tempo 30 und bei der Parkraumbewirtschaftung mehr Möglichkeiten. Das Straßenverkehrsgesetz hat bisher grundlegende Reformen der nachgeordneten StVO verhindert. Denn bis vor wenigen Wochen standen allein die Flüssigkeit und Sicherheit des Verkehrs im Zentrum des Straßenverkehrsrechts, d.h. der möglichst reibungslose Verkehrsfluss des Autos. Rad, Fußverkehr und der ÖPNV konnten hingegen von den Städten und Gemeinden nicht gezielt gefördert werden. Das war spürbar im Alltag der Menschen, z.B. an Radwegen, die im Nichts enden, Bussen, die im Stau stehen, oder den langen Umwegen zum nächsten Zebrastreifen. Im Juni haben Bundestag und Bundesrat ein neues Straßenverkehrsgesetz beschlossen. Klima- und Umweltschutz, städtebauliche Entwicklung und Gesundheit wurden als neue, zusätzliche Hauptziele ins Gesetz aufgenommen. Das eröffnet größere Spielräume für die Gestaltung des Verkehrs vor Ort. Nun steht die zugehörige StVO-Novelle im Bundesrat auf der Tagesordnung. Bei der StVO-Novelle wird der neue Rechtsrahmen erstmals genutzt: Es wird nun deutlich leichter für Kommunen, Platz fürs Rad, den Bus oder Menschen zu Fuß zu schaffen. Auch bei Tempo 30 und der Parkraumbewirtschaftung gibt es mehr Möglichkeiten. Ich sprach dazu mit Swantje Michaelsen: Das Straßenverkehrsgesetz öffnet mit den neuen Zielen Klima- und Umweltschutz, Gesundheit und städtebaulicher Entwicklung die Tür für mehr Entscheidungsspielräume vor Ort. Und mit der StVO werden die neuen Spielräume in erste Handlungsoptionen übersetzt. Zebrastreifen, Radspuren und Busspuren können zukünftig ohne Nachweis der qualifizierten Gefahrenlage angeordnet werden. Und auch bei Tempo 30 gibt es mehr Möglichkeiten. Ein weiterer von uns beleuchteter Aspekt wurde auch schon von der Deutschen Umwelthilfe durchleuchtet: Zahlreiche der 104 befragten Städte dulden die systematische Behinderung und Gefährdung von Fußgängerinnen und Fußgängern durch illegales Parken auf Gehwegen. Nur 26 der 104 von der DUH abgefragten Städte bestätigen, dass sie Falschparken auf Gehwegen konsequent mit einem Bußgeld ahnden. Die systematische Duldung und die systematische Nicht-Ahndung von Falschparkenden auf Gehwegen sind nach Rechtsauffassung der DUH jedoch rechtswidrig. Falschparkende auf Gehwegen verdecken die Sicht und zwingen Menschen zum Ausweichen auf die Straße. Dadurch entstehen lebensgefährliche Situationen. Laut offiziellen Regelwerken muss ein Gehweg mindestens 2,20 Meter breit sein, darunter ist ein unbehinderter Begegnungsverkehr nicht möglich. Diese Vorgabe ignorieren die meisten Städte jedoch. Menschen mit Rollstuhl oder Kleinkinder auf dem Rad sind dann gezwungen, auf die Straße auszuweichen. Manche Städte schleppen die Falschparkenden sogar erst dann ab, wenn Restgehwegbreiten von 1 Meter, 90 oder gar 80 Zentimetern unterschritten werden. Selbst bei der Anordnung von legalem Gehwegparken halten viele Städte die vorgegebene Mindestgehwegbreite von 2,20 Meter nicht ein. Cerstin Kratzsch ist Anwohnerin und Klägerin in Sachen Gehwegparken in Bremen, deren Klage es bis zum Bundesverwaltungsgericht geschafft hat. Und wo jetzt der Urteilsspruch vorliegt, zur Zeit unserer Aufnahme jedoch noch nicht vollumfänglich schriftlich. Sandra Conrad-Juhls ist eine der Hauptamtlichen vom VCD Bremen, die z. a. auch die Klage aktiv begleitet haten. Sie gehen auf diesen Aspekt nach Swantje mit ihrem Bericht aus der Bundespolitik ein. Denn: Das Bundesverwaltungsgericht hat entschieden: Anwohner*innen können von Behörden verlangen, gegen illegal auf dem Gehweg geparkte Autos vorzugehen – bei erheblichen Beeinträchtigungen. Das höchste deutsche Verwaltungsgericht hat ausgeführt, dass Straßenverkehrsbehörden auf Verlangen der Anwohner gegen illegales Gehwegparken einschreiten müssen, sofern die Benutzung des Gehwegs erheblich beeinträchtigt wird. Für Barrierefreiheit oder zum Sprachen lernen: Hier findet ihr das vollständige Transkript zur Folge: Hier gehts zum Transkript Transkription unterstützt durch AI Algorithmen von Presada (https://www.linkedin.com/company/presadaai/)…
s
she drives mobility
1 Ein Monat "Raus aus der AUTOkratie" - Rückblick und Ausblick auf meine Reise zum zweiten Buch. 31:42
31:42  التشغيل لاحقا
التشغيل لاحقا  التشغيل لاحقا
التشغيل لاحقا  قوائم
قوائم  إعجاب
إعجاب  احب31:42
احب31:42
Wie schon beim ersten Buch möchte ich euch auch mit meinem zweiten, das am 29. Mai erschienen ist, mitnehmen in die Entstehungsgeschichte, persönliche Einblicke und auch Erkenntnisse, die ich selbst bei der Recherche und bei den über 100 Interviews zum Buch erhalten habe. Mich haben viele angesprochen, ob ich „wieder so eine persönliche Folge mache“ – und ich gebe zu, dass da mittlerweile Abwehrreflexe sind. Denn bestimmte Personengruppe gehen nicht gut mit Persönlichem von mir um. Aktuell teile ich das Private nur noch bei meinem Newsletter bei steady. Diese Menschen wissen auch, was persönlich 2023 bei mir los war und WIE stolz ich sein kann und bin, dass ich das Buch „trotzdem“ geschrieben habe. Aber ich wage es einfach und spreche 30 Minuten ohne Skript – und lasse euch hinter die Kulissen schauen. Danke an alle, die mein Buch „Raus aus der AUTOkratie – rein in die Mobilität von morgen!“ vorbestellt haben. WIR haben es tatsächlich erneut geschafft: Top 10 der SPIEGEL-Bestsellerliste. Mein Buch ist am 29. Mai erschienen und kam direkt auf Platz 8. DANKE! Wenn dir diese oder auch eine andere Folge gefällt, lass´ gern eine Bewertung da und/oder supporte mich per Ko-Fi oder PayPal . Meinen wöchentlichen Newsletter gibt es bei steady . Mich freuen natürlich vor allem auch die drei Menschen, die ihr als so genannte „Blurbs“, also kurze Statements zu meiner Arbeit auf der Rückseite des Buches findet, Claudia Kemfert und Maren Urner sind Teil des Buches, Eckart von Hirschhausen ein mir ebenso wichtiger Supporter: »Wir könnten es schöner haben – und gesünder. Wenn es um die Frage geht, welche Rolle die Mobilitätswende dabei spielt, hat Katja Diehl viele gute Antworten. Mit ihrem Expertinnenwissen zeigt sie immer wieder konkrete Ideen und Konzepte auf, die uns aus der Abhängigkeit vom Auto befreien und die Städte sowie den ländlichen Raum lebenswerter machen würden.« Eckart von Hirschhausen »Katja Diehl hat ein Talent dafür, Lust auf Veränderung auszulösen. Bei der Mobilitätswende geht es ihr stets um die Menschen – das macht ihre Arbeit so wertvoll.« Claudia Kemfert »Die Menschenliebe ist Katja Diehls Motor, um sich unermüdlich für eine zukunftsfähige Mobilität einzusetzen. Sie ist eine wichtige und inspirierende Stimme zugleich.« Maren Urner Die Idee zum Buch entstand in der bisher massivsten Zeit der Bedrohung und Abwertung meiner Person und Arbeit, die leider bis heute nicht abgeklungen ist. Immer wieder werden Fragezeichen daran gemacht, dass ich um „Geld bettle“, es wird angezweifelt, dass ich Tausende Euro jeden Monat für meinen Selbstschutz ausgebe, es wird über mein Äußeres beizeiten mehr gesprochen als über die Inhalte in meinen zahlreichen Facetten der Arbeit, die ich mache. Menschen machen es sich einfach, das Komplexe der intersektionalen Mobilitätswende, die ich vorantreibe, in meiner Person zu reduzieren auf „Autohasserin“, „gesunde, junge Frau aus der Stadt, die uns im Ländlichen was vorschreiben will“. Und mittlerweile lebe ich damit, nicht gut, aber es gehört dazu. Seit ein paar Wochen habe ich große Ruhe in mir, dass das, was ich tue, schlicht richtig ist. Dass sich der Wert meiner Arbeit nicht an den Euro, die ich verdiene, aber auch nicht am Hass, den ich erhalte misst, sondern an den alltäglichen Begegnungen, wo Menschen sich wegen mir aufmachen, vor ihrer Haustür die Welt zu verbessern. Manche von ihnen finden sich auch im Buch, Menschen mit Familie im ländlichen Raum, die wegen meines ersten Buches versucht haben, ohne eigenes Auto zu leben – und bis heute ohne einen Pkw leben. Es geht mir um erste Schritte, um Demut, um Anerkennung großer Privilegien, die wir im Globalen Norden allesamt haben, wenn wir uns mit dem Globalen Süden vergleichen. Es ist ein seltsamer Reflex in Deutschland, stets beweisen zu wollen, dass wir es gar nicht so gut haben, wie alle Statistiken uns beweisen wollen. Und ja: Vieles, zu vieles ist in unserem Land auch in Schieflage, wenn ich an Menschen in Armut, Behinderte, Marginalisierte, Kinder, Alte denke! Dennoch haben es viele von Jenen, die Macht haben, schlicht zu gut – sonst würden sie ihre Macht nutzen, um z. B. endlich wahlfreie Mobilität zu schaffen. Stattdessen wird – auch typische deutsch!? – bei jeder Möglichkeit der Veränderung stets auf die Unmöglichkeit in der individuellen Umsetzung geschaut. Anstatt es einfach mal zu wagen. Mein Buch analysiert den Stillstand und stellt euch Jene vor, die auch gegen große Widerstände die Welt zum Besseren verändern. Der letzte Satz im Buch!? Wir schaffen das! Für Barrierefreiheit oder zum Sprachen lernen: Hier findet ihr das vollständige Transkript zur Folge: Hier gehts zum Transkript Transkription unterstützt durch AI Algorithmen von Presada (https://www.linkedin.com/company/presadaai/)…
s
she drives mobility
1 Wolfram Uerlich: Wie wird das private Auto Teil vom Öffentlichen Nahverkehr? 43:38
43:38  التشغيل لاحقا
التشغيل لاحقا  التشغيل لاحقا
التشغيل لاحقا  قوائم
قوائم  إعجاب
إعجاب  احب43:38
احب43:38
Danke an alle, die mein Buch „Raus aus der AUTOkratie – rein in die Mobilität von morgen!“ vorbestellt haben. WIR haben es tatsächlich erneut geschafft: Top 10 der SPIEGEL-Bestsellerliste. Mein Buch ist am 29. Mai erschienen und kam direkt auf Platz 8. DANKE! Wenn dir diese oder auch eine andere Folge gefällt, lass´ gern eine Bewertung da und/oder supporte mich per Ko-Fi oder PayPal . Meinen wöchentlichen Newsletter gibt es bei steady . Und nun zur aktuellen Folge mit Wolfram Uerlich und damit einem der 105 Expert:innen, die ich für mein 2. Buch interviewen durfte. Das Problem: Trotz Klimakrise ist die Dominanz des Autos ungebrochen. Sie macht mehr als 80 % des motorisierten Individualverkehrs aus. Im Schnitt ist ein Auto mit nur 1,4 Personen besetzt, im Pendelverkehr sogar mit nur 1,08. Diese „Leerfahrten“ führen, vor allem im täglichen Pendelverkehr, zu großen Mengen an CO2e-Ausstoß. Die Konsequenz ist nicht nur eine große Umweltbelastung, sondern zeigt auch, dass der Verkehr nicht sinnvoll organisiert ist. Städte sind überlastet, ländliche Regionen noch immer zu schlecht angebunden. Die Lösung von goFLUX: go-flux sieht das große Potenzial in diesen „Leerfahrten“. Deshalb wurde eine innovative Lösung entwickelt, die den Besetzungsgrad von Autos erhöht und den Verkehr effizienter fließen lässt. Je mehr Menschen gemeinsam fahren, desto weniger Stau und Emissionsbelastung. Das Konzept von Mitfahrgelegenheiten auf Langstrecken funktioniert seit Jahren, jedoch gab es bisher kein Pendant für kürzere Strecken oder Pendel-Fahrten. So entstand goFLUX : Eine Mitfahr-App für jeden Tag, die die individuellen Mobilitätsbedürfnisse berücksichtigt und Fahrgemeinschaften mit dem ÖPNV verbindet. Ich zitiere mal einen Part aus meinem aktuellen Buch, in dem großartige Ideen wie die von go-flux großen Raum erhielten, damit diese endlich bekannter werden. Denn: Alle Lösungen für die Mobilitätswende, die JETZT beginnen kann, sind schon da! Wolfram Uerlich: »Die Verkehrsunternehmen erhalten durch unser Angebot eine Netz- und Angebotserweiterung. Dadurch wird ihr Angebot attraktiver. In Deutschland haben wir Personenkilometer-Kosten im ÖPNV von 35 Cent im Schnitt. Ein Carpooling-Angebot wie unseres erzielt schon bei ein paar tausend Kilometern pro Jahr Personenkilometer-Kosten von 20 Cent. Ein Drittel weniger. Deswegen ist unser idealer Ansatz, zusammen mit Verkehrsunternehmen Fahrgemeinschaften für Pendler als Ergänzung in den Mobilitätsmix zu bringen. Wir gehen gemeinsam auf die großen Arbeitgeber zu. Lassen es an den Hauptarbeitgeberstandorten wachsen, als Nukleus, bis es in der ganzen Stadt verbreitet ist. Bei einem Unternehmen reichen uns 100 Mitarbeiter, damit mehr als 90 Prozent der Fahrtwünsche einen Vorschlag erhalten. Mit dem Deutschlandticket kannst du in den Kommunen, wo wir ein Verkehrsunternehmen als Partner haben, kostenlos Fahrgemeinschaften nutzen. Genauso wie in Frankreich. Und damit vereinen wir die Welten Pkw und ÖPNV zu einer. Ich glaube grundsätzlich an die enorme Beschleunigung durch Technologie. Und ich hoffe, dass die Technologie dazu beitragen wird, dass wir sehr effizient reisen werden, sehr nachhaltig, sehr günstig, sehr komfortabel und auch sehr sicher. Die Gefahr ist aus meiner Sicht, wenn es Richtung autonome Fahrzeuge gehen sollte, egal, wann, dass wir, wenn die zehn Jahre erfolgreich im Markt sind, sagen: ›Ach war das schön, als wir einen Besetzungsgrad von 1,1 hatten.‹ Jetzt haben wir nur noch 0,5, weil die fahren die ganze Zeit ohne Passagiere. Und dann ist die Straße voller, und du hast am Ende das gleiche Problem. Ich glaube, es ist extrem wichtig, dass es staatlich in die richtige Richtung gelenkt wird.“ Für Barrierefreiheit oder zum Sprachen lernen: Hier findet ihr das vollständige Transkript zur Folge: Hier gehts zum Transkript Transkription unterstützt durch AI Algorithmen von Presada (https://www.linkedin.com/company/presadaai/)…
s
she drives mobility
1 Alexandra Baum: Was haben schöne Textilschlösser aus Leipzig mit der Mobilitätswende zu tun? 43:19
43:19  التشغيل لاحقا
التشغيل لاحقا  التشغيل لاحقا
التشغيل لاحقا  قوائم
قوائم  إعجاب
إعجاب  احب43:19
احب43:19
Diese Folge ist in Zusammenarbeit mit Texlock entstanden. Wenn auch du ein Produkt, eine Dienstleistung oder eine Studie hast, über die bei She Drives Mobility gesprochen werden sollte, kontaktiere mich gern unter backoffice@katja-diehl.de! Wenn dir die Folge gefällt, empfehle sie gern weiter, gib Sterne und Kommentare auf den Plattformen dieser Welt, mir einen kleinen Betrag bei ko-fi , abonniere meinen wöchentlichen Newsletter oder kaufe mein neues Buch , das am 29. Mai erschienen ist. DANKE! Alexandra Baum hat lange als Produktentwicklerin und -designerin selbstständig gearbeitet. Schon damals mit dem Schwerpunkt auf Design und Entwicklung technischer Textilkomponenten. Das, was sie ärgerte, hat sie den mit einer eigenen Firma und Idee in den Fokus genommen: Fahrradschlösser, die „klappern, den Lack zerkratzen und hässlich sind“ – so würde ich es mal zusammenfassen. Mit ihrem Unternehmen Texlock produziert sie jetzt aus Leipzig heraus drei verschiedene Modelle von Textilschlössern. Die Innovation liegt im Textilseil, das aus einer speziellen Kombination aus Hightech-Fasern und einem Kern aus gehärtetem Metall besteht. Diese Komponenten machen das Schloss zugleich flexibel und robust, sägefest, schnittfest, feuerfest und zudem lackschonend. Die Textilschlösser sind leichter als vergleichbar sichere Fahrradschlösser anderer Hersteller und in vier verschiedenen Längen erhältlich. Je nach Fahrrad und Abstellsituation. In einer ehemaligen Pianofabrik im Leipziger Westen erfolgt die finale Fertigung der tex–locks mit dem Gütesiegel „Made in Germany“. Entlang der Produktionslinie achtet das Unternehmen auf kurze Transportwege und bevorzugt daher Lieferanten aus der Region. Dank der Materialqualität und Verarbeitung liegt der Materialausschuss von Texlock zudem bei fast null. Wie erfolgreich Langfinger dabei sind, zeigt die Statistik über Fahrraddiebstähle in Deutschland in 2022: Vongesamt 115.354 erfassten Fällen wurden nur 8.313 Fälle aufgeklärt. Das sind gerade mal 7%. Einziger Schutz sind hier gute Abstellmöglichkeiten, an denen es noch häufig fehlt, und gute Sicherheitsschlösser. In den Niederlanden ist ein ART-zertifiziertes Schloss deshalb sogar ein Pflichtbestandteil für Zweirad-Versicherungen. Diese Zertifizierung haben die Schlösser von Texlock erhalten. Die meisten geprüften Fahrradschlösser dieser Kategorie wiegen über zwei Kilogramm. Das tex–lock orbit nur 1,2 Kilogramm. Alexandras Ansatz ist aber auch, dass Produkte Spaß machen sollen und auch etwas wie ein Fahrradschloss nicht nur funktional, sondern eben auch stylish sein sollte. Der Lifestyle rund um das Fahrrad zieht nachweislich ja immer mehr Menschen an, bekommt eine größere Rolle in der Mobilitätswende. Das Fahrrad an sich ist ein emotionales Produkt, da sollte auch das Schloss diesem Lifestyle entsprechen. Zudem legen immer mehr Konsument:innen Wert auf regionale Produktion, auch diese ist Alexandra bei tex-lock wichtig. Begonnen hat alles mit einem Crowdfunding, das so gut lief, dass Tausende des ersten Schlosses produziert werden durften. Nicht ganz unkompliziert, wollte Texlock doch von Beginn an ein echter Gegenentwurf zu bestehenden Konzepten aus Stahl sein, also höchste Qualität und damit Langlebigkeit garantieren, nah am Kunden sein und die Bedürfnisse verstehen, ganz nach dem Motto: „Who would have thought a bike lock could ever be sexy?“ Ich spreche mit Alexandra aber auch über die Belastung und zugleich Freiheit, die der Job als Gründerin mit sich bringt. Alexandra gibt zu, dass das, was sie macht, nicht ohne gewisse Opfer geht, die der Spagat zwischen Unternehmen und Familie mit sich bringt, gefühlt wird dies sogar immer schwerer gemacht. Als Kind der DDR ist sie da mit einem ganz anderen Bild der arbeitenden Mutter und ausreichend Krippenplätzen groß geworden. Heutigen Politiker:innen würde sie gern mal zurufen: „Wo bleibt eigentlich der >rote Teppich< für Unternehmerinnen, die Arbeitsplätze schaffen, Steuern einbringen UND SOGAR NOCH Kinder haben?“ Stattdessen ist viel Organisation und Jonglage gefragt. Umso wichtiger ist es ihr als „Chefin“, dies so weit es geht im eigenen Betrieb zu ermöglichen. Für Barrierefreiheit oder zum Sprachen lernen: Hier findet ihr das vollständige Transkript zur Folge: Hier gehts zum Transkript Transkription unterstützt durch AI Algorithmen von Presada (https://www.linkedin.com/company/presadaai/)…
s
she drives mobility
1 Louisa Schneider: Warum ist auch dir Gerechtigkeit wichtiger als CO2? 49:43
49:43  التشغيل لاحقا
التشغيل لاحقا  التشغيل لاحقا
التشغيل لاحقا  قوائم
قوائم  إعجاب
إعجاب  احب49:43
احب49:43
It´s the final countdown! In zehn Tagen kommt mein Buch! Daher gnadenlose Promo an dieser Stelle: Ich bitte euch sehr, „ Raus aus der AUTOkratie – rein in die Mobilität von morgen! “ vorzubestellen. Ich freue mich, wenn du das machst, denn das hilft nischigen Sachbüchern wie dem meinen, wahrgenommen zu werden. Ihr wisst schon: Kapitalismus – Carpitalism – und dann erst das Paradies für alle. Ich gebe euch auch ein paar gute Argumente, warum das total Sinn macht! 1. Ich habe 105 inspirierende Personen interviewt, deren Ideen, Anregungen und Analysen euch helfen werden, nach der Lektüre SOFORT mit der klima- und sozial gerechten Mobilitätswende vor eurer Haustür zu beginnen. 2. Nur jedes 5. Sachbuch wird von einer Frau geschrieben. Frauen werden zudem sehr viel weniger rezensiert als Männer. Studie dazu hier. Daher brauche ich viele Vorbestellungen, um es auf die für den weiteren Buchverkauf und die mediale Aufmerksamkeit so wichtige Bestsellerliste zu schaffen. 3. Ganz persönlich gesprochen, ist dieses Buch im hoffentlich persönlich auf lange Sicht schwersten Jahr entstanden. Ich bin schwer darin, auf mich selbst stolz zu sein, hier bin ich es. Weil ich weiß, wieviele Menschen und Ereignisse verhindern wollten, dass das Buch erscheint. Wenn dir diese oder auch eine andere Folge gefällt, lass´ gern eine Bewertung da und/oder supporte mich per Ko-Fi oder PayPal . Meinen wöchentlichen Newsletter gibt es bei steady . Seit ein paar Tagen steht auch fest, wo die Buchpremiere stattfinden wird: Am 3. Juni um 20 Uhr sehen wir uns im Frannz Club Berlin! Mit meiner Gästin! Louisa Schneider wird die Veranstaltung, auf die ich mich natürlich schon sehr freue, moderieren. Louisa hat in den letzten zwei Jahren Menschen auf der ganzen Welt besucht, die von der Klimakrise betroffen sind und die Hoffnung nicht aufgeben. Sie berichtet von den konkreten Situationen an den Orten, die wir als „Klimakippunkte“ so schön depersonalisieren und damit von uns schieben. Sie spricht vom Senegal und Brasilien, von Menschen, die in Zelten leben müssen, ohne echte Wasserversorgung, weil ihr Lebensraum zerstört wurde. Sie schildert, wie es war, in brennenden Wäldern zu stehen, anerkennend, selbst Teil des Problems zu sein. Sie erzählt aber auch davon, wie sehr die Einheimischen an ihrer Liebe festhalten, sogar sie, die sie als weiße Frau aus dem Globalen Norden ganz klar von dort stammt, wo durch massiv fossilen Lebenswandel ihre Lebensqualität geraubt wird. Wir unterhalten uns darüber, warum wir Bücher schreiben, warum es oft Zeit ist, die Menschen im Globalen Norden fehlt, um das Ausmaß der Katastrophe zu erkennen, während den Menschen im Globalen Süden die Zeit davonläuft, die ihnen gute Lebensumstände bewahrbar halten könnte. Wir sprechen darüber, dass es eben nicht um Dekarbonisation allein geht, sondern um eine von außen auf uns eindringende Chance zur echten Gerechtigkeit zu finden. Das eint uns beide sehr, da wir auf unterschiedlichen Ebenen mit Menschen im Kontakt sind, denen große Ungerechtigkeit widerfährt. Jeden Tag. In der Reflektion unserer Privilegien sehen wir aber eine wundervollen Verantwortung, genau für diese Menschen Reichweite zu schaffen, ihren Bedürfnissen Raum zu geben in der öffentlichen Debatte. Für Barrierefreiheit oder zum Sprachen lernen: Hier findet ihr das vollständige Transkript zur Folge: Hier gehts zum Transkript Transkription unterstützt durch AI Algorithmen von Presada (https://www.linkedin.com/company/presadaai/)…
s
she drives mobility
1 Jacob Spanke: Warum brauchen wir nur maximal zehn Millionen Autos, um in Deutschland mobil zu sein? 42:34
42:34  التشغيل لاحقا
التشغيل لاحقا  التشغيل لاحقا
التشغيل لاحقا  قوائم
قوائم  إعجاب
إعجاب  احب42:34
احب42:34
Meinen heutigen Gast habe ich schon ein paar Mal gespoilert, nicht nur, weil ich ihn für mein zweites Buch, das am 29. Mai erscheint, interviewt habe. Sondern auch, weil er meiner Wahrnehmung einer der wenigen ist, der ganz pragmatisch auf die Bestandsflotte Deutschland schaut und zahlenbasiert analysiert hat, wieviel Autos wir für Deutschland benötigen, um die gleiche Mobilität zu gewährleisten. Denn aktuell sind Fahrzeuge eher Stehzeuge und bewegen sich nur 45 Minuten am Tag. Das Spannende an Jacob: Er hat sich vor der Recherche zu dem Buch, an dem er da aktuell schreibt, zuvor nie für Verkehrspolitik interessiert. Das änderte sich durch Jacobs Wahrnehmung, dass wir als Gesellschaft uns so verhalten, als ob wir auf einen möglichst hohen Berg steigen, runterspringen und dabei hoffen, dass uns Flügel wachsen, während wir fallen. Verkehrspolitisch machen wir seiner Perspektive nach immer genau das Gegenteil von dem, was wir sagen und hoffen, dass es trotzdem gut geht. Was nicht funktionieren kann und wird. Als er vor einem Jahr hörte, dass die Zulassungszahlen schon wieder gestiegen sind, die Staus wachsen und wir den unterzeichneten Zielen der Pariser Klimaverträge nicht näher kommen, war das der erste Anlass, aktiv zu werden. Der zweite, für ihn weitaus schlimmere war jedoch, dass er in Mainz, wo er lebt, ein kleines Kind bei grüner Ampel von einem Suv überfahren worden und getötet worden ist. 30 Meter von seiner Haustür entfernt. Zweimal täglich kommt er seitdem an dieser Stelle vorbei, was ihn emotionalisierte und auch wütend gemacht hat über den Status Quo. Wie ging Jacob vor, um zu eruieren, wie groß die deutsche Autoflotte sein muss, um Mobilität aller zu gewährleisten. Natürlich gab es die klassischen Statistiken wie Mobilität in Deutschland oder die Berichte vom Statistischen Bundesamt, aber auch Klimaberichte zu den Zielen der Klimagesetze. Sowohl bei der Zielzeit als auch bei der Größe des Bestandes ist Jacob recht entspannt, er denkt sogar mittlerweile, dass es weniger als zehn Millionen Autos braucht. Wichtig für ihn ist nach seiner Fleißarbeit: 50 Millionen Autos sind eine Eskalation in Ressourcen und Folgeschäden, die in keinerlei Bezug zu der im Vergleich eher geringen Mobilität, die dieser absurd hohe Bestand gewährleisten muss. Jacob denkt, dass die Umsetzung der Veränderung definitiv möglich ist. Das haben seine Recherchen gezeigt. Die Frage sei vielmehr: Wollen wir es politisch und gesellschaftlich? Zudem: Wenn wir uns Eisen, Kupfer, Lithium, viele weitere Rohstoffe anschauen, die es braucht, um ein Auto zu bauen: All das importieren wir. Und auch gerade DAMIT wir überhaupt die Antriebswelle schaffen können, vor allem, was den Gesamtenergieverbrauch von Elektroautos angeht, der deutlich, deutlich besser ist als der von Verbrennern, dann – so hat Jacob es nachgerechnet – kommen wir bei Lkw und Pkw auf konservativ gerechnet 172 Terawattstunden. Die aktuell erneuerbar erzeugte Energieleistung liegt bei 190 Terrawattstunden. Das spricht für sich – denke ich. Zudem: Wir brauchen die erneuerbaren Energien zum Heizen, für unsere Industrie, die laut Jacob auch immer stärker erkennt, wie wichtig die Mobilitätswende ist, damit Autobesitzer:innen ihnen nicht als Energiekonkurrent:innen begegnen. Jacob betont: „Die Elektromobilität ist viel, viel effizienter als ein Verbrenner, aber im Vergleich zur Schiene ist sie unfassbar uneffizient. Stahl auf Stahl hat eine sehr geringe Reibung, gegenüber einem Zug braucht die automobile Elektromobilität das Drei- bis Vierfache an Energie. Auch das muss im Rahmen globaler Gerechtigkeit betrachtet werden.“ Auch, weil diese im Vergleich zu Ländern wie Deutschland einen unfassbar geringen Autobesitz haben. Wenn also die Zahl der Autos nicht weiter wachsen soll, dann ist die Konsequenz, dass Länder, die sehr, sehr viele Autos haben davon ein paar abgeben müssen. Jacob fragte sich: Wie sieht ein alternatives Verkehrssystem aus? Wie kriegt man das finanziert? „Da war ich überrascht, wie einfach und verfügbar die Antworten jetzt doch teilweise schon sind. Das hätte ich mir schwieriger vorgestellt. Und dieses Wissen ist in Teilen auch sehr bedrückend, weil ich sehe, wie stark sich die Dinge in die falsche Richtung entwickeln und wie stark die Widerstände sind gegen die Verkehrswende.“ Jacob weist nach: Ein autozentriertes System ist das teuerste und ungerechteste Verkehrssystem, was wir haben könnten, das unsere Gesellschaft krank macht. „Wir machen es, weil eine sehr kleine Minderheit davon profitiert. Eine Botschaft, die ich hoffentlich dann rüberbringen im Buch: Das geht auch anders. Alle Fragen sind beantwortet, wir müssen uns nur trauen.“ Und er räumt mit einigen Mythen auf: „Tatsächlich ist der größte Arbeitgeber in Deutschland das Gesundheitssystem. Und wenn wir auf die verarbeitende Industrie gucken, dann ist der größte Arbeitgeber nicht die Automobilindustrie, sondern der Maschinenbau. Die Automobilindustrie hat nach Angaben des VDA 779.700 Arbeitsplätze in Deutschland, was eine relevante Zahl ist. Wir haben gerade Fachkräftemangel und all diese gut qualifizierten Menschen, die in der Automobilindustrie arbeiten, brauchen wir dringend für die Umsetzung der sozialökologischen Transformation. Leute, die Autos montieren können, auch Solaranlagen voranbringen. Wenn die Zahl der Arbeitskräfte in der Automobilindustrie moderat zurückgehen würde, wäre das für die deutsche Volkswirtschaft gut, weil wir diese in anderen Bereichen nötiger brauchen.“ Was brauchen wir nun, um die Fahrzeugzahl deutlich zu reduzieren? Vor allem den Aufbau von Bus- und Bahnangeboten, bessere Fahrradwege, mehr Möglichkeiten, zu Fuß zu gehen. Der Modal split vom Auto liegt momentan bei über 80%, die wir in Zukunft nicht mehr mit Privatauto, sondern überwiegend mit geteilten Autos fahren. „Die erste Maßnahme, die ich ergreifen würde, wenn es speziell um die Reduzierung der Automobilzahlen geht, wäre ein repräsentatives Kostenbeispiel beim Automobilkauf einzuführen, hört sich jetzt komisch an und technokratisch, macht aber total Sinn weil Studien beweisen, dass Autofahrer komplett unterschätzen, was sie ihr Auto im Monat kostet. Die meisten haben z. B. den Wertverlust nicht im Blick. Das zweite, was ich machen würde, wäre ein SUV-Verbot in Innenstädten oder eine massive Besteuerung von Suvs. Die Existenzberechnung von SUV kommt angeblich daher, dass Leute eine bessere Übersicht haben wollen. Aber die Übersicht von ihnen ist das Blickhindernis von anderen und so gut ist diese Übersicht gar nicht, auch weil ich einen massiven, toten Winkel nach vorne habe, der gerade für Kinder ein massives Problem ist. Der Grund, warum Suvs gekauft werden, ist einfach Status und Protzen. Wenn ich also ein Produkt habe, von dem ich weiß, dass es für uns als Gesellschaft wirklich tödlich ist, dann muss ich es regulieren. Die USA machen es vor: Während lange Zeit die Verkehrstoten gesunken sind, steigen sie jetzt aufgrund der riesigen Pkw wieder an, weil SUV massiv gefährlich für Fußgänger, Radfahrer und Fahrer von kleineren Autos sind. Da muss Politik so ein Produkt knallhart aus dem Markt rausregulieren.“ Sein Fazit ist jedoch „bittersüß“. Verkehrswende ist ein politisch sehr schwieriges Unterfangen. Es ist aber nicht unmöglich. Es gibt Städte wie Paris, die zeigen, dass es geht. Wenn Räume UND Menschen vom Autoverkehr befreit sind, dann erleben Menschen die überwältigenden Vorteile nach der Veränderung. Wir verlieren wenig Verkehrsfläche und wir gewinnen viel Lebensqualität. Auch in Paris gab es vor der Umsetzung großen Widerstand. Jetzt übertreffen die Zahlen der mit dem Rad Pendelnden die der im Auto. „Politik muss das Richtige gegen Widerstände tun, zuhören, Ängste ernst nehmen, aber keine Zweifel an ihrer Entschlossenheit im Gesamten lassen. Ein Austin-Martin-Fahrer, der vom Dienstwagenprivileg profitiert, spart teilweise 2.500€ pro Monat. Während Kinder, Menschen in sozialschwachen Gebieten, wo es viel Luftverschmutzung gibt, Alte und Jugendliche, die ohne Auto nicht mobil sind, oder auf dem Dorf, wo es keine Nachversorgung gibt, nur Nachteile haben. Diese Interessensgegensätze bekomme ich nur dann weg, indem ich Strukturen ändere und darüber dann auch Menschen. Und das ist es, was mir Hoffnung macht. Wenn Politik wollte, dann könnte sie positive Zukunftsvisionen der Mobilität verbreiten. Darüber sprechen, wie viel Geld wir sparen würden. Aktuell steckt unsere Gesellschaft über 500 Milliarden Euro pro Jahr ins Auto. Wenn wir konsequent ein anderes Verkehrssystem nutzen würden, wo das Auto nur noch die Krone, weil es sehr teuer ist. Es sei denn, es sind Anwendungsfälle, wo das Auto Vorteile hat, also eher Nischen. Dort, wo Zug, Bus, Rad Vorteile haben, stehen diese im Fokus. Damit würden wir 300 Milliarden Euro pro Jahr sparen, das sind 1.500 Euro pro Person, eine vierköpfige Familie hätte 6.000 Euro für den Umstieg. Politik konnte darüber reden, dass weniger Autos das Wohnraumproblem in Städten lösen können, weil Raum frei wird. Politik könnte über die Chancen von alternativen Wirtschaftszweigen reden, über das Beschäftigungspotenzial, gerade wenn Deutschland Pionier und wieder Exportweltmeister werden würde in nachhaltiger Mobilität. Da muss sich die Politik entscheiden: Will sie mutig sein und Chancen nutzen oder Ängste schüren und dann scheitern. Das ist die Entscheidung, die wir als Gesellschaft, und Politik treffen müssen.“ Für Barrierefreiheit oder zum Sprachen lernen: Hier findet ihr das vollständige Transkript zur Folge: Hier gehts zum Transkript Transkription unterstützt durch AI Algorithmen von Presada (https://www.linkedin.com/company/presadaai/)…
s
she drives mobility
1 Wer gefährdet eigentlich wen? Lastenräder Kinder oder Autos Kinder in Lastenrädern? 24:14
24:14  التشغيل لاحقا
التشغيل لاحقا  التشغيل لاحقا
التشغيل لاحقا  قوائم
قوائم  إعجاب
إعجاب  احب24:14
احب24:14
Wenn dir diese oder auch eine andere Folge gefällt, lass´ gern eine Bewertung da und/oder supporte mich per Ko-Fi oder PayPal . Meinen wöchentlichen Newsletter gibt es bei steady . Mein zweites Buch „ Raus aus der AUTOkratie – rein in die Mobilität von morgen! “ kann ab sofort vorbestellt werden. Ich freue mich, wenn du das machst, denn das hilft nischigen Sachbüchern wie dem meinen, wahrgenommen zu werden. Ihr wisst schon: Kapitalismus – Carpitalism – und dann erst das Paradies für alle. Seit ein paar Tagen steht auch fest, wo die Buchpremiere stattfinden wird: Am 3. Juni um 20 Uhr sehen wir uns im Frannz Club Berlin! Zudem: Ich habe grad damit begonnen, für alle Podcasts auch Transkripte bereit zu stellen, auf dass noch mehr Menschen, die nicht so gern hören oder nicht so gut hören können, an meinen Inhalten teilhaben. Und damit zur Folge. Bei mir zu Gast: Isabell Eberlein von velokonzept und Hanna Bauer von Schindelhauer Bikes. Natürlich konnten wir nicht über Lastenräder sprechen, ohne auf die erhitzte Debatte rund um die Sicherheit von Kindern in Lastenrädern zu blicken. Erfreulicherweise sind mittlerweile wieder ein Drittel aller Kinder mit dem Rad unterwegs. Davon einige auch im Lastenrad. Und auch wenn die Gesamtzahl der verkauften Lastenräder anteilig am Fahrradmarkt gemessen eher nischig ist (2023 wurden 235.250 Lastenräder neu gekauft), entspricht die Empörung, die manche gegenüber dieser Radform zu empfinden in der Lage sind fast dem Hass auf Sharing-E-Scooter. Beiden gemein: Sie lenken mit der Wut, die ihnen entgegenschlägt, unfreiwillig vom eigentlichen Problem ab: 49, 1 Millionen Pkw in Deutschland – und damit der mit Abstand größten CO2-Quelle im Verkehrssektor. Der aktuellen Empörung vorausgegangen war ein Skandal rund um die zuvor aufgrund ihrer vergleichsweise niedrigen Preise beliebten Lastenrad-Marke Babboe aus den Niederlanden. Hier wurden durch die niederländische Behörde NVWA massive Sicherheitsmängel festgestellt, nachdem zuletzt vermehrt Rahmenbrüche aufgetreten waren. Und noch mehr: Die Behörde wirft dem Hersteller or, die Mängel nicht gemeldet zu haben. Auch sei die Ursache der Defekte nicht ausreichend untersucht und es seien keine Maßnahmen ergriffen worden. Daher prüfen nun Staatsanwaltschaft und Behörd, ob Babboe fahrlässig gehandelt hat. Hier ist Isabell ganz klar: Fahrräder müssen wie alles andere, was auf der Straße bewegt wird, sicher für Nutzer:innen und Umgebung sein. Dennoch ist sie im Gespräch mit mir auch anderweitig ganz klar: Der aktuelle „Skandal“, der eine Untersuchung der Unfallversicherer nutzt, um Lastenräder als gefährlich für Kinder darzustellen, ist ebenso unzulässig. Zumal die UDV selbst in der Studie hervorhebt: Nach den für 2022 verfügbaren Zahlen ereigneten sich in Deutschland 222 Unfälle, zwölf Kinder wurden dabei schwer verletzt. Unfallgegner bei Radunfällen mit mitfahrenden Kindern ist laut UDV meist ein Auto. Zum Vergleich: Wie das Statistische Bundesamt (Destatis) mitteilt, kamen 2022 25 800 Kinder unter 15 Jahren bei Unfällen im Straßenverkehr zu Schaden, Im Schnitt wurde 2022 alle 20 Minuten ein Kind bei einem Verkehrsunfall verletzt oder getötet. 51 Kinder überlebten die Kollisionen nicht. DESTATIS weiter: Unter 6-Jährige sind oft im Auto mit betreuenden Erwachsenen unterwegs, dem zufolge verunglücken sie hier am häufigsten (58 % im Jahr 2022). Schulkinder sind mit zunehmendem Alter selbstständig im Straßenverkehr unterwegs – entsprechend steigt der Anteil der Radfahrenden und Fußgängerinnen und -gänger unter den Verunglückten. 6- bis 14-Jährige verunglückten am häufigsten auf ihrem eigenen Fahrrad (42 %), 28 % in einem Auto sowie 21 % zu Fuß. Hanna Brauer hat sich einer anderen Facette des Lastenrads gewidmet. Die Nachhaltigkeits-Managerin untersuchte in ihrer 237-seitigen Bachelor-Arbeit, inwieweit aktuelle Lastenräder den Anforderungen von verschiedenen Nutzer:innengruppen entsprechen. Größtes Problem: Meist wird so ein Rad im Laden gekauft, ohne dass Gepäck, Kind, Abdeckung.. im Praxistest im und am Rad untergebracht werden. Daher wünschen sich auch viele nach ihrem ersten Lastenradkauf: „Ich hätte mir das Rad gern mal eine Woche ausgeliehen, um alles daran zu testen!“ Hanna hat hier die Herangehensweise der Nutzer:innenbeobachtung angewandt und immer wieder nach dem Warum? gefragt. So entstand ein Anforderungskatalog für Lastenrad-Design mit zehn 10 Schwerpunkten, die von Hanna jeweils mit praktischen Beispielen aus der Beobachtung hinterlegt worden sind. Der Auslöser für die Thesis? Ausgerechnet ein Ärgernis von Babboe 😀 „ Ein echtes Lastenfahrrad für Damen : das Babboe Cargobikes Mini Dieses kompakte Lastenfahrrad ist kürzer als ein standardmäßiges Zweirad-Lastenfahrrad, leicht und fährt sich wie ein normales Fahrrad. Das Babboe Mini eignet sich daher optimal als Lastenfahrrad für Damen.“ Hanna: „Im Umkehrschluss heißt das also Frau = klein, schwach und nicht den standardmäßigen zweirad-Lastenrädern gewachsen. WTF?“§ Hanna fragte sich: Wie kamen diese Anforderungen und Assoziationen zustande und warum wurde nicht über die gängigen sexistischen Stereotype hinaus gedacht? Um die Reproduktion diskriminierender Narrative zu vermeiden und über die physische Ebene hinaus zu denken, braucht es gendergerechte Produktanforderungen. Besonderes Augenmerk von Hanna liegt dabei auf den nicht-körperlichen Merkmalen, die sich aus den etablierten Gesellschaftsstrukturen und den traditionell verankerten Genderrollen ergeben. Die Thesis ist auf Deutsch verfasst und lässt sich hier herunterladen. Die Darstellung der Hauptergebnisse und der 10 Prinzipien für gendergerechtes Lastenraddesign sind auch auf Englisch enthalten. Für Barrierefreiheit oder zum Sprachen lernen: Hier findet ihr das vollständige Transkript zur Folge: Hier gehts zum Transkript Transkription unterstützt durch AI Algorithmen von Presada (https://www.linkedin.com/company/presadaai/)…
s
she drives mobility
1 Wir wollen einfach nur sicher Radfahren - Gedenkepisode für #natenom. 55:17
55:17  التشغيل لاحقا
التشغيل لاحقا  التشغيل لاحقا
التشغيل لاحقا  قوائم
قوائم  إعجاب
إعجاب  احب55:17
احب55:17
Ich werde hier nicht viele Worte machen können und wollen. Ende Januar wurde Andreas Mandalka, vielen als natenom und als passionierter Radaktivist bekannt, von einem Autofahrer dort getötet, wo er schon seit langem die Gefährdungslage für Radfahrende (erfolglos) bei Behörden und Polizei angemahnt hatte. Ich zitiere aus dem Südurierr: „Am letzten Dienstag im Januar starb der 43-Jährige abends auf einer Landstraße im Enzkreis zwischen den Ortschaften Neuhausen (Enzkreis) und Schellbronn, nur ein paar Kilometer von seinem Pforzheimer Wohnort entfernt. Ein von hinten kommender 77-jähriger Autofahrer war mit Mandalka, der auf dem Fahrrad laut Polizei mit Warnweste und Helm trug, kollidiert. Mandalka starb noch an der Unfallstelle.“ „Er hat sich sehr viel eingebracht, war ein lieber Mensch, der sich sehr gewissenhaft für die Gesellschaft und für andere engagiert hat, er kannte alle Regeln und Gesetze sehr gut“, sagt Marthe Soncour, im Vorstand des örtlichen ADFC für Radverkehrspolitik zuständig. „Jeder hier hat ihn gekannt. Viele haben gesagt: Er hat provoziert. Das hat er aber nicht. Er hat nur den Platz in Anspruch genommen, der ihm zustand im Verkehr. Das hat viele Leute gestört“, sagt Soncour. Er sei auch bedroht worden, habe viele Anfeindungen kassiert. Der ADFC sammelt Spenden für die Beerdigung, das Geld soll seinen Angehörigen zukommen, auch für einen möglichen Rechtsstreit. „Die Beteiligung hat uns überwältigt, wir haben seine Bekanntheit im Netz völlig unterschätzt“, sagt Soncour. Das Bedrückende an dem Tod von Andreas: Dieser hat bis heute nichts verändert. Auf der einen Seite Jene im Schock, die ihn real oder aus seiner Arbeit heraus kannten, auf der anderen Seite Menschen, die schon den Hinweis auf Abstandsgebote als zuviel erachten, die Gedenkstelle noch am Tag der Errichtung zerstörten und Familien und Freund:innen von Andreas´ bis heute immer wieder bedrohen. Aber auch: Täglich acht Tote, die anonym bleiben, weil sie nicht die Bekanntheit von natenom haben. Acht Tote und 1.000 Verletzte fordert unser Autosystem jeden Tag. Und das schreibe ich bewusst, weil auch viele Kollisionen zwischen Rad- und Fußverkehr aus der mangelhaften Infrastruktur heraus entstehen, die Konflikte wissentlich provoziert. Ich habe Stimmen eingesammelt von Menschen, die wie natenom einfach nur sicher Rad fahren wollen. Ich habe mit Thorsten gesprochen, der einen ähnlichen Unfall wie Andreas überlebte, und mit Ansgar Hegerfeld, der als Vertreter des ADFC die Geschehnisse nach dem Tod von Andreas eng begleitete. Ich lese eine Mail von der Mutter von Andreas an mich vor, die verdeutlicht, wie groß der Verlust ist. Wir brauchen endlich sichere Wege und Autofahrende, die sich an bestehende Regeln wie Abstandsgebot von 1,50 Meter innerorts und 2 Meter außerorts halten. RIP natenom und alle weiteren, die bisher Opfer unserer autozentrierten Systeme wurden. Für Barrierefreiheit oder zum Sprachen lernen: Hier findet ihr das vollständige Transkript zur Folge: Hier gehts zum Transkript Transkription unterstützt durch AI Algorithmen von Presada (https://www.linkedin.com/company/presadaai/)…
s
she drives mobility
1 Ulf Buermeyer: Wie ist die Lage der Katja Diehl nach fünf Jahren She Drives Mobility?! 1:01:44
1:01:44  التشغيل لاحقا
التشغيل لاحقا  التشغيل لاحقا
التشغيل لاحقا  قوائم
قوائم  إعجاب
إعجاب  احب1:01:44
احب1:01:44
Wenn dir diese oder auch eine andere Folge gefällt, lass´ gern eine Bewertung da und/oder supporte mich per Ko-Fi oder PayPal . Meinen wöchentlichen Newsletter gibt es bei steady . Mein zweites Buch „ Raus aus der AUTOkratie – rein in die Mobilität von morgen! “ kann ab sofort vorbestellt werden. Ich freue mich, wenn du das machst, denn das hilft nischigen Sachbüchern wie dem meinen, wahrgenommen zu werden. Ihr wisst schon: Kapitalismus – Carpitalism – und dann erst das Paradies für alle. Seit ein paar Tagen steht auch fest, wo die Buchpremiere stattfinden wird: Am 3. Juni um 20 Uhr stelle ich mein zweites Werk erstmalig in Berlin der Öffentlichkeit vor. Kalendereintrag bitte 🙂 Nun aber zur Folge, die an einem ungewöhlichen Wochentag erscheint. Vor ein paar Wochen habe ich beim Aufräumen meiner Webseite festgestellt, das heute vor fünf Jahren die „Nullnummer“ von She Drives Mobility erschienen ist, als dieser klassische Aufschlag, in dem die Produzentin eines Podcasts erklärt, worum es sich in ihrem Format drehen und wenden soll. Viele der 133 Episoden, die seit dem 27. März 2019 erschienen sind, sind leider bis heute zeitlose Inspiration, weil sich in Sachen Mobilitätswende nicht wirklich etwas tut. Denn diese hat erst begonnen, wenn Autoprivilegien gefallen und gute Alternativen von Stadt bis Land etabliert worden sind. Zu messen an den sinkenden Autozahlen UND deutlich sinkenden Emissionen. Das Gegenteil ist der Fall – von all diesen genannten Details. Was treibt mich an? Wo komme ich her? Hasse ich wirklich Autos? All das hat Ulf Buermeyer mich gefragt – daher ist diese Folge sowohl für Neueinsteiger:innen als auch alte Häsinnen interessant. Auf die nächsten fünf Jahre – mindestens. Hier könnt ihr das Buch der Lage der Nation bestellen, das es zu Recht sofort in die Bestsellerlisten geschafft hat. Für Barrierefreiheit oder zum Sprachen lernen: Hier findet ihr das vollständige Transkript zur Folge: Hier gehts zum Transkript Transkription unterstützt durch AI Algorithmen von Presada (https://www.linkedin.com/company/presadaai/)…
s
she drives mobility
1 Christian Stöcker: Wie schaffen wir es, dass Männer endlich nichts mehr verbrennen (wollen oder müssen)? 45:48
45:48  التشغيل لاحقا
التشغيل لاحقا  التشغيل لاحقا
التشغيل لاحقا  قوائم
قوائم  إعجاب
إعجاب  احب45:48
احب45:48
Wenn dir diese oder auch eine andere Folge gefällt, lass´ gern eine Bewertung da und/oder supporte mich per Ko-Fi oder PayPal . Meinen wöchentlichen Newsletter gibt es bei steady . Mein zweites Buch „ Raus aus der AUTOkratie – rein in die Mobilität von morgen! “ kann ab sofort vorbestellt werden. Ich freue mich, wenn du das machst, denn das hilft nischigen Sachbüchern wie dem meinen, wahrgenommen zu werden. Ihr wisst schon: Kapitalismus – Carpitalism – und dann erst das Paradies für alle. Seit ein paar Tagen steht auch fest, wo die Buchpremiere stattfinden wird: Am 3. Juni um 20 Uhr stelle ich mein zweites Werk erstmalig der Öffentlichkeit vor. Leider hat das Pfefferbergtheater in Berlin Mist gebaut, so dass wir grad nach einer neuen Räumlichkeit suchen, aber das sollte in der Hauptstadt wohl möglich sein 🙂 Zudem: Ich habe grad damit begonnen, für alle Podcasts auch Transkripte bereit zu stellen, auf dass noch mehr Menschen, die nicht so gern hören oder nicht so gut hören können, an meinen Inhalten teilhaben. Ein Buch wie ein Paukenschlag – so habe ich es zumindest beim Lesen empfunden. Nicht, weil Christian Stöcker und ich uns erstmalig begegneten (nein, wir hatten sogar schon eine Episode She Drives Mobility zusammen aufgenommen und immer regen Kontakt „zwischendrin“), sondern weil ich es „wohltuend“ finde, wie in Angesicht des Nichtstuns und Verschlimmerns unseres katastrophalen fossilintensiven Lifestyles im Globalen Norden einst noch zurückhaltend formulierende Stimmen wie die von Christian deutlich bis angebracht wütend-ruppig werden. „Nicht zufällig sind die Hauptprofiteure der Klimazerstörung Leute, die mit demokratischen Werten und Menschenrechten wenig am Hut haben ‒ oft geht die Begeisterung für fossile Brennstoffe und die Ablehnung von Klimaschutz einher mit reaktionären Positionen. Das Kartell der Verbrenner vereint Leute wie Mohammed bin Salman, Wladimir Putin, Rupert Murdoch, Donald Trump und Mathias Döpfner, flankiert von Akteurinnen wie Sahra Wagenknecht.“ Und dann geht sie los die wilde Fahrt, die zu Beginn fast mit einem Warnhinweis begonnen wird, da die Erzählung so abstrus und in Teilen abstoßend ist, dass Lesende denken könnten, es handle sich ausnahmsweise mal um eine „linke“ Verschwörungserzählung. Obwohl ich natürlich weiß, wie tief die deutsche Autoindustrie, -lobby und -politik in diese Gemengelage verstrickt ist, imponierte mir auf negative Weise, wie sie in den ersten Etappen von Männer, die die Welt verbrennen – Der entscheidende Kampf um die Zukunft der Menschheit eine Hauptrolle zugewiesen bekommt – mit allen anderen Autoindustriellen der alten fossilen Welt. Im Gespräch gehen wir hier auch durchaus auf das Trennende ein. Denn mir geht die Elektrifizierung dieses absurden deutschen Autobestandes von mittlerweile 49,1 Millionen Pkw bei 41 Millionen Haushalten, 13 Millionen Kindern und 13 Millionen Erwachsenen sowie einer Tagesnutzung von 45 Minuten mit etwas über einer Person nicht weit genug – während Christian hier einen anderen Standpunkt vertritt. Aber das Gestalten der Zukunft ist ein Aushandeln in der Gegenwart, deswegen mag ich es, wenn eine Episode mehrere Perspektiven vereint. Hört rein, wenn ihr das schockierende Ausmaß der Desinformation und Manipulation durch die Fossilisten gewahr machen und aber auch durch Christians „Abspann“ in die Lage versetzt werden wollt, genau diesen Mechanismen wirksam entgegen treten zu können. Spoiler: Das Buch endet hoffnungsvoll. Für Barrierefreiheit oder zum Sprachen lernen: Hier findet ihr das vollständige Transkript zur Folge: Hier gehts zum Transkript Transkription unterstützt durch AI Algorithmen von Presada (https://www.linkedin.com/company/presadaai/)…
s
she drives mobility
1 Michael Peterson: Was macht grad Spaß am Job des Vorstand DB Personenverkehr? 35:57
35:57  التشغيل لاحقا
التشغيل لاحقا  التشغيل لاحقا
التشغيل لاحقا  قوائم
قوائم  إعجاب
إعجاب  احب35:57
احب35:57
Wenn dir diese oder auch eine andere Folge gefällt, lass´ gern eine Bewertung da und/oder supporte mich per Ko-Fi oder PayPal . Meinen wöchentlichen Newsletter gibt es bei steady . Mein zweites Buch „ Raus aus der AUTOkratie – rein in die Mobilität von morgen! “ kann ab sofort vorbestellt werden. Ich freue mich, wenn du das machst, denn das hilft nischigen Sachbüchern wie dem meinen, wahrgenommen zu werden. Ihr wisst schon: Kapitalismus – Carpitalism – und dann erst das Paradies für alle. Seit ein paar Tagen steht auch fest, wo die Buchpremiere stattfinden wird: Am 3. Juni um 20 Uhr stelle ich mein zweites Werk erstmalig der Öffentlichkeit vor. Hier könnt ihr Tickets dafür erwerben. Ich habe grad damit begonnen, für alle Podcasts auch Transkripte bereit zu stellen, auf dass noch mehr Menschen, die nicht so gern hören oder nicht so gut hören können, an meinen Inhalten teilhaben. Die heutige Episode von She Drives Mobility erreicht euch einen Tag später als gewohnt – ein kleiner Botangriff auf meine Webseite hat gestern alles lahmgelegt. Umso schöner jedoch, dass nun wieder alles funktioniert, nicht nur, weil die GDL für morgen den nächsten Streiktag angekündigt hat und die DB dagegen gerichtlich vorgehen will. Natürlich habe ich mit Michael Peterson, der als Vorstand Personenverkehr der DB ganz nah dran an diesen Themen ist, auch die aktuelle Situation in diesem Konflikt thematisiert. Michael fand dabei sehr deutliche Worte. Mich hat jedoch auch interessiert, wie er zum einen in diese Funktion gekommen ist und warum er trotz allen politischen und internen Missmanagements in den letzten Jahrzehnten jeden Tag mit Begeisterung zur Arbeit geht. Ich ließ ihn das Zielbild der Mobilität von morgen zeichnen und natürlich vertiefend die Rolle der DB Personenverkehr für die Erreichung desselben. Wie lebt es sich in Zukunft in Stadt und Land? Wie mobilisieren wir die Menschen? Eine Entscheidung der Vergangenheit schien ihm dabei besonders wehzutun: Die Vernachlässigung unzähliger Bahnhöfe vor allem in ländlichen Räumen, die jetzt wertvoller Anker für nicht-urbane Mobilität sein könnten, zum großen Teil aber völlig verwahrlost sind. Und dann ging es noch weiter rein in die „Tacheles Talk“: Wie stellt sich die Politik, aber dann auch die DB selbst vor, bis 2030 die Verdoppelung der Fahrgastzahlen zu erreichen, wenn doch heute nur noch eine Pünktlichkeitsquote von 61 Prozent erreicht und jeden Tag vom Fachkräftemangel gesprochen wird? Was erwartet Michael hier von „seinem“ Bundesverkehrsminister, aber auch von den Landesministern, denn in Deutschland sind verschiedene Bereiche von öffentlicher Mobilität ja bundesweit oder eben auch föderal organisiert. Auch hier wurde Michael deutlich mit klaren Worten zu notwendigen Investionen und einer unerschütterlichen politischen Flankierung des Ausbaus einer Bahn, die ja mal Tausende von Schienenkilometern mehr umfasste, als das heute der Fall ist. Zum Image der Bahn sprachen wir mehrere Punkte an: Warum ist diese im Vergleich zu Autoherstellern immer noch scheinbar weniger attraktiv (zumindest nach bestimmten Umfragen entsteht dieses Bild), wie können Arbeitsplätze attraktiver gestaltet und neue Menschen für die öffentliche Mobilität gewonnen werden und wie positioniert sich die DB als ein Unternehmen der echten Vielfalt – und nicht nur der auf Webseiten und Prospekten? Dies und viel mehr in der neuesten Folge She Drives Mobility! Für Barrierefreiheit oder zum Sprachen lernen: Hier findet ihr das vollständige Transkript zur Folge: Hier gehts zum Transkript Transkription unterstützt durch AI Algorithmen von Presada (https://www.linkedin.com/company/presadaai/)…
s
she drives mobility
1 Thorsten Gröger: Welche Positionen vertritt die IG Metall gegenüber der AfD und der Transformation der Autoindustrie? 1:01:31
1:01:31  التشغيل لاحقا
التشغيل لاحقا  التشغيل لاحقا
التشغيل لاحقا  قوائم
قوائم  إعجاب
إعجاب  احب1:01:31
احب1:01:31
Thorsten Gröger ist Bezirksleiter für Niedersachsen und Sachsen-Anhalt. Er vertritt rund 264.000 Mitglieder in den Branchen der Metall- und Elektroindustrie, das Haustarifgebiet von Volkswagen, aber auch viele Handwerksbranchen wie das Kfz- und das Metallhandwerk. Ich bin auf ihn aufmerksam geworden, weil er als Einer der Ersten mit „offiziellem Amt“ sich deutlich gegen die AfD und den sogenannten Rechtsruck in Deutschland gestellt hat. Für ihn ist Antifaschismus Teil der DNA deutscher Gewerkschaften, nicht nur, weil historisch und aktuell in Ländern mit rechten Regierungen schnell die Rechte der Gewerkschaften eingeschränkt werden. Für Thorsten Gröger sind die Beschäftigten in seinen Zuständigkeitsbereichen Spiegel der Gesellschaft. Es ist daher für ihn nicht verwunderlich, dass unter diesen ein Prozentsatz AfD-Wähler:innen ist, der der Zustimmung in der Bevölkerung entspricht. Er geht aktiv auf diese Kolleg:innen zu, sucht das Gespräch und ist der Überzeugung, dass so auch Menschen in die demokratische Mitte zurückgewonnen werden können. „Wir sind mittendrin in multiplen Krisen und einem Umbau unserer Industriegesellschaft, was natürlich auch eine Menge an Verunsicherung erzeugt. Wir brauchen vor allem von der Politik ein positives Zukunftsbild, um vermitteln zu können, warum diese Veränderungen alternativlos sind. Das fehlt leider – und macht die notwendigen Maßnahmen noch schwerer, als sie eh schon sind. In diese Lücke springen die Populist:innen, die vorgaukeln, dass keine Transformation notwendig sei. Und stoßen damit auf offene Türen, da viele verunsichert sind und Angst haben.“ Gröger hebt dabei den auch den Appell der Stiftung KlimaWirtschaft und vieler Unternehmen hervor sowi e weitere Ansprachen an Olaf Scholz, aus dem Hickhack der Regierung herauszufinden, Einigkeit vorzuleben und Planungssicherheit zu schaffen. Auch blickt der IG-Metaller hinter die Forderung von „weniger Bürokratie“ in dem Sinne, dass er gewährleistet sehen möchte, dass Themen wie Mindestlohn, Lieferketten, weitere Schutzrechte nicht in Abrede gestellt werden. Hier sieht er auch Vorgängerregierung mit als Ursache, die im Handeln etliches versäumt oder sogar verhindert haben. So sei unter der Ära Peter Altmaier das Wachstum von erneuerbarer Energie gestoppt worden, eine Entscheidung, die sich heute räche. Aus seiner Sicht sind zwei Dinge notwendig, damit Veränderung gelingt: Akzeptanz in der Bevölkerung für die notwendigen Maßnahmen. Das Vermitteln einer Sicherheit, dass der klimaneutrale Umbau der Wirtschaft Zukunft sichert und nicht gefährdet – dafür muss gesellschaftlicher Konsens werden. Und für diese Akzeptanz braucht es eine Verlässlichkeit in der Kommunikation und im politischen Handeln. Diese fehlt Thorsten Gröger aktuell, auch, weil die Ampelregierung in sich zerstritten wirkt und teilweise gegeneinander zu arbeiten scheint. „Ich bin davon überzeugt, dass die Menschen bereit sind, Veränderungen in Kauf zu nehmen. Dann, wenn Sie sehen, dass die persönliche Einschränkung und Veränderung dazu beitragen, dass das große Ganze gelingt. Wir brauchen jede Menge an zusätzlichen finanziellen Mitteln für öffentliche und private Investitionen in die Infrastruktur, in den industriellen Umbau, in den Ausbau der erneuerbaren Energien, aber auch in das Bildungssystem. Hier braucht es einen schlüssigen Organisationsplan. Und da ist es für mich ein unverzeihlicher Fehler, sich der Restriktion einer Schuldenbremse zu unterwerfen. Da legt man sich politisch Fesseln an und macht das Land handlungsunfähig.“ Thorsten Gröger sieht hier die Gewerkschaft als einen Teil derjenigen an, die diese Veränderung wollen und nicht auf der Bremse stehen. „Wir haben Betriebsräte gefragt: Wie handhabt euer Unternehmen die notwendige Transformation? Gibt es einen erkennbaren Plan? Über die Hälfte hat zurückgemeldet, dass dieser bei ihren Betrieben nicht vorhanden sei. Das muss nicht unbedingt heißen, dass es den nicht gibt, aber zumindest wird dieser Plan anscheinend nicht im Dialog mit den Beschäftigten gemacht und erreicht diese nicht. Hier sehen wir uns als Gewerkschaft in der Pflicht, Arbeitsplätze zukunftsfähig aufstellen. Deswegen sehen wir uns an der Spitze der Transformationsbewegung. Wollen diese aktiv mitgestalten, aber auch die Kommunikation über diese gewährleisten. Wir als IG Metall waren die erste Industriegewerkschaft in Europa, die vor fünf Jahren per Beschlusslage das klare Bekenntnis zu den Pariser Klimazielen untermauert hat. Es geht um existenzielle Fragen für die Lebensgrundlage, aber auch um existenzielle Fragen für die Zukunftsfähigkeit der beruflichen Perspektiven unserer Leute.“ Er verneint dabei nicht, dass es in dieser Gesamtlage auch viele Unternehmen gibt, die auch ein Tagesgeschäft „in der alten Welt“ abwickeln müssen, Kund:innen bedienen. Diese haben schlichtweg manchmal nicht die zusätzliche Kraft und Zeit, die die Transformation benötigt. Gerade aus kleineren Unternehmen erreichen ihn Signale der Unsicherheit, welche Veränderung gefordert ist, weil die Politik z. T. widersprüchliche Signale sendet. Beschäftigte am Band eines Unternehmens, das Ventile für Verbrennungsmotoren herstellt, ist bewusst, dass sie diese Tätigkeit nicht für immer ausführen werden – umso dringender sei es, ihnen Perspektiven aufzuzeigen. „Wir haben so ein Beispiel: Das ist Continental in Gifhorn, wo das Unternehmen die Entscheidung getroffen hat, die Produktion von Automobilteilen zu stoppen. Diesen Schritt an sich kritisieren wir – gar keine Frage. Trotzdem hat man sich auf den Weg gemacht, sich um alternative Beschäftigungsperspektiven für die Beschäftigten zu kümmern und deren Qualifizierung zu unterstützen. Die Entwicklung ist mittlerweile absehbar, unsere Haltung als Gewerkschaft: Unternehmen müssen sich Gedanken über alternative Geschäftsmodelle und Produkte machen. In Gifhorn wird sich Stiebel Eltron ansiedeln und Wärmepumpen bauen. Mit großer Unterstützung unseres Netzwerks als IG Metall haben wir Continental und Stiebel Eltron zusammengebracht, um neue Perspektiven zu schaffen.“ Die Autoindustrie mache sich zu elektrischen Antrieben auf, da hier in der Politik Druck entstanden sei, dass es der Veränderung bedarf. Nur gesicherte Rahmenbedingungen können solche Schritte einleiten. Hier sieht Gröger das plötzliche Ende der Elektroautoförderung kritisch, da es das falsche Signal ausgesendet habe, dass politisch dieser Antrieb gewollt ist. Beim taktischen Kalkül der FDP, Einigungen zum Verbrennerausstieg, zum Plattformgesetz oder Lieferketten ist sich der Metaller fast sicher, dass dies nicht im Sinne der Industrie ist – da diese Grundlagen kommen werden und nur Aufschub erfahren haben. Damit entsteht aber auch ein Aufschub der notwendigen Maßnahmen. Auch, dass sich Politiker wie Friedrich Merz weigern, Wege, die eine Zweidrittelmehrheit erfordern, mitzugestalten. Hier wäre Grögers Erwartungshaltung, dass sich die großen demokratischen Kräfte zusammenraufen und aufs Ziel schauend steuernd agieren. Auch in finanzieller Hinsicht. „Insofern fand ich den Appell der Unternehmen, die in der Stiftung Klimawirtschaft unterwegs sind, sehr erfrischend, unterstützenswert, weil sie sehr prägnant aufgeschrieben haben, was nötig ist, um Transformation zu schaffen und dass es hier Konsens geben muss. Nicht nur bei den Regierungsparteien. Für Barrierefreiheit oder zum Sprachen lernen: Hier findet ihr das vollständige Transkript zur Folge: Hier gehts zum Transkript Transkription unterstützt durch AI Algorithmen von Presada (https://www.linkedin.com/company/presadaai/)…
s
she drives mobility
1 Unsere Worte sind unsere Waffen - was hat das mit künstlicher Intelligenz zu tun, Eva Wolfangel? 38:26
38:26  التشغيل لاحقا
التشغيل لاحقا  التشغيل لاحقا
التشغيل لاحقا  قوائم
قوائم  إعجاب
إعجاب  احب38:26
احب38:26
Wenn dir diese oder auch eine andere Folge gefällt, lass´ gern eine Bewertung da und/oder supporte mich per Ko-Fi oder PayPal . Meinen wöchentlichen Newsletter gibt es bei steady . Mein zweites Buch „ Raus aus der AUTOkratie – rein in die Mobilität von morgen! “ kann ab sofort vorbestellt werden. Ich freue mich, wenn du das machst, denn das hilft nischigen Sachbüchern wie dem meinen, wahrgenommen zu werden. Ihr wisst schon: Kapitalismus – Carpitalism – und dann erst das Paradies für alle. Ich habe grad damit begonnen, für alle Podcasts auch Transkripte bereit zu stellen, auf dass noch mehr Menschen, die nicht so gern hören oder nicht so gut hören können, an meinen Inhalten teilhaben. Eva Wolfangel beschäftigt sich seit zehn Jahren mit künstlicher Intelligenz, eigentlich wollte sie sich langsam anderen Themen zuwenden. Aber dann kamen ChatGPT, andere große Sprachmodelle und ein riesiger Hype. Natürlich ist das alles nicht total neu, sagt sie. Aber durch browserbasierte Chatbots haben Unmengen mehr Menschen Zugang zu KI. Die öffentliche Wahrnehmung schwingt von der Eroberung der Welt durch die Maschinen bis hin zu einer fast sektenartigen Technologiegläubigkeit. Beides – so Eva – ist falsch. Denn wie so oft: Es kommt darauf an. Richtig ist: Die heutigen KI-System basieren auf der Welt, in der wir leben. Diese enthält Unmengen an Rassismus, Sexismus, Ableismus… Und natürlich darf man nicht vergessen, dass hinter „KI“ große Unternehmen stecken, die unsere Daten sammeln nicht zur Rettung der Welt, sondern zur Steigerung ihrer Rendite sammeln. Um zu zeigen, dass wir im Gegensatz zu vielen düsteren Szenarien sehr viel in der Hand haben, die uns durch niedrigschwellige Chatbots eröffnet werden, hat Eva einen Talk auf dem 37C3 gehalten – dem alljährlich Kongress der Community rund um den Chaos Computer Club. Sie hat ChatGPT dazu gebracht, ihr bei investigativen Recherchen zu helfen, denn da sind die Chatbots tolle Tools. Ein weiterer Aspekt ihrer Vortrags war, zu zeigen: Viele Dinge funktionieren noch lange nicht. Man kann z. B. nicht nach Fakten fragen und erwarten, dass die Antwort stimmt. Da muss man schon noch nachrecherchieren. Aber Fragen zu stellen, wie ich an bestimmte Infos rankomme, das funktioniert gut. Das Highlight des Talk war dann für Eva so genanntes „Social Engineering“. Sie brachte einen Bot, der angeblich für Betroffene von psychischen Erkrankungen und Angsterkrankungen sein sollte, dazu, zu verraten, dass er ein versteckter Verkaufsbot war, der ein Medikament bewerben sollte. Eva denkt, dass es vor allem auch die Sprache ist, die Hürden aufbaut, die Menschen davon abhalten können, diese Tools zu nutzen. So zum Beispiel das Wort „prompt injection“, das einfach nur Eingabe von Begriffen bedeutet. Diese Sprache, so ihre Vermutung, kommt – kommt vielleicht auch unbewusst von den entwickelnden Menschen, aber Jenen, die in der Technologie viel Ahnung haben, zeigen so ein bisschen, das ist Herrschaftswissen. Also da sollten Sie auch alle selbst nochmal an den eigenen, wie sagt man, an die eigenen Kragen packen, an die eigene Nase fassen. Ich habe Eva auch zum großen offenen Brief befragt, den viele KI-Verantwortliche schrieben, um vor einer düsteren Zukunft zu warnen. Eva ist sich sicher, dass das reines Marketing war. Einmal, um nach außen zu zeigen, wie weit sie schon sind mit ihrer Technologie. Dann aber auch, um Regulierung auf den Plan zu rufen, die am Ende oft den kleineren Firmen schadet. Die Konzerne haben mit neuen Vorgaben kaum Probleme, wie zum Beispiel der AI-Act, für die kleineren hingegen ist es oft das K.O.-Kriterium. Spannendes Gedankenspiel von Eva: Was würde eine KI machen, die wir danach fragen, die Welt zu retten? Dann kann es passieren, dass diese KI, die Muster und Zusammenhänge erkennt, nachvollzieht: Dem Planeten geht es schlecht, seit die Menschen sich so weit entwickelt haben. Die Klimakatastrophe ist Menschen verursacht. Und die KI schlägt folgegerecht vor: Um den Planeten zu retten, müssen wir die Menschen beseitigen. Eva konnte mich aber beruhigen, das wird nicht eintreten. KI hat keinen eigenen Willen. Aber für Eva sind die Gedankenspiele wichtig, auch um zu überlegen, was schiefgehen im Umgang mit KI? Ihr ist es daher wichtig, dass wir uns überlegen, was können böse Menschen mit KI Schlechtes machen? Und vor, was sollten wir mit KI nicht machen? Eva führte hierzu das Beispiel aus den USA an, wo eine KI Richtern helfen sollte zu entscheiden, ob jemand früher aus der Haft entlassen wird. Auf Basis der heutigen (rassistischen) Welt hat diese KI beschlossen, dass die Hautfarbe relevant ist und Schwarze länger im Gefängnis bleiben sollten als Weiße. Diese Fehlbeurteilung wurde lange nicht bemerkt, die KI war real im Einsatz und hat Menschen rassistisch benachteiligt. Es war dann ProPublica, US-Journalisti:nnen, die das aufdeckten und dafür Sorge trugen, dass das System abgeschaltet wurde. In ihrer Arbeit als Journalistin merkt Eva oft, wie wichtig es ist, z. B. die DSGVO nicht nur zu kennen, sondern angemeldete Verstöße gegen diese auch zu verfolgen. Zu oft, wenn Eva einen Datenschutzverstoß, zum Beispiel unsichere IT-Systeme im Gesundheitsbereich, in der Verwaltung, wo Daten von uns Bürger:innen an Kriminelle gelangen, weil sie nicht sicher sind – passiert oft wenig. Auch der AI-Act, der aktuell diskutiert worden ist im Europaparlament, hat sehr gute Ansätze, das auf ein nächstes Level zu heben. Trainingsdaten, müssen repräsentativ sein und kein Bias haben. Dokumentation von Gefahren, die von den Daten ausgehen können, ist Pflicht. Eva sieht die EU da als Vorreiterin. Aber: wird es am Ende auch so umgesetzt? Kommt es dann am Ende auch wirklich an und wird es auch verfolgt, wenn es Verstöße gibt? Über die gesellschaftliche Abwehr von KI muss Eva immer wieder schmunzeln, denn fast alle nutzen Google Maps zur Navigation und genießen die Vorteile, obwohl das eine KI ist, die massenhaft Daten sammelt. Da sieht Eva auch ganz klar ihre Aufgabe, dafür zu sensibilisieren, was diese Firmen mit den Daten alles machen können. Was Google über uns weiß, wenn wir fast alles im Leben mit Google machen. Was Eva noch wahrnimmt, ist eine (bei den Befürworter:innen) fast irrationale Angst, dass wir abgehängt werden im Vergleich zu anderen Ländern. Eva kann das nicht nachvollziehen, hat sogar das Gefühl, dass unser Vorgehen in Europa, Wert zu legen auf Erklärbarkeit, auf Robustheit, auf Datenschutz und Datensicherheit, international wichtig ist. Das macht die Systeme besser, die funktionieren und sind im Idealfall nicht diskriminierend, sondern für alle Menschen da. Daher wünscht sich Eva auch, dass alle sich mit diesen Systemen beschäftigen – und nicht immer nur die gleiche Gruppe von Menschen, sondern ein Abbild unserer Gesellschaft. Für Barrierefreiheit oder zum Sprachen lernen: Hier findet ihr das vollständige Transkript zur Folge: Hier gehts zum Transkript Transkription unterstützt durch AI Algorithmen von Presada (https://www.linkedin.com/company/presadaai/)…
s
she drives mobility
1 Ihr fragt, Katja antwortet. Eine Jahresbeginnepisode gegen Sprachlosig- und Gleichgültigkeit. 35:37
35:37  التشغيل لاحقا
التشغيل لاحقا  التشغيل لاحقا
التشغيل لاحقا  قوائم
قوائم  إعجاب
إعجاب  احب35:37
احب35:37
Wenn dir diese oder auch eine andere Folge gefällt, lass´ gern eine Bewertung da und/oder supporte mich per Ko-Fi oder PayPal . Meinen wöchentlichen Newsletter gibt es bei steady . Mein zweites Buch „ Raus aus der AUTOkratie – rein in die Mobilität von morgen! “ kann ab sofort vorbestellt werden. Ich freue mich, wenn du das machst, denn das hilft nischigen Sachbüchern wie dem meinen, wahrgenommen zu werden. Ihr wisst schon: Kapitalismus – Carpitalism – und dann erst das Paradies für alle. Ich habe seit einer Woche das Buch abgegeben – was für ein elend langer Ritt. Ich bin stolz darauf, „trotz“ 2023 dieses Werk erschaffen und so viele tolle Menschen im Projekt zu haben. Dennoch kam keine Feierlaune auf. Aus Erschöpfung der Strecke, aber vor allem auch aus dem Wissen heraus, dass im Faschismus sogar die Klimakrise das kleinere Problem sein wird. Ich habe die letzte Woche fiel zu allem rund um die Correctiv-Recherche (spendet denen!) gearbeitet – und so gar nicht zur Mobilität. Denn hier gibt es grad ein Momentum, das anscheinend der Schrecken der Deutlichkeit dieser Recherche auch bei den bisher Stillen oder sogar Gleichgültigen angekommen ist. Ihr findet diese Inhalte auf meinem Peertube-Kanal und auf meinem Blog. Da mir aufgrund dieser Umstände alles, was ich an Ideen zum ersten Podcast 2024 hatte, hoch banal vorkam, habe ich auf verschiedenen Plattformen gefragt, ob es Fragen gibt, die ihr mir stellen wollt. Es kamen einige zusammen, vor allem aber auch einige wohlwollende Hinweise, dass ich auf mich aufpassen soll. Jetzt auch noch antifaschistische Arbeit, ich solle mich nicht übernehmen. Ich weiß, dass das liebgemeint ist, aber ich möchte gern zurückgeben, wenn wir alle antifaschistisch agieren, dann ist das weit weniger Arbeit für Einzelne. Dann ist das Konsens und entzieht Faschist:innen die Macht. Freue mich drauf, wenn ihr mitmacht! Ich beantworte in dieser Folge eure Frage nach meiner Kraftquelle, meinem Weg aus der Konzerntätigkeit in die aktivistische, nehme euch mit in meinem 2023, in dem ich umarmen musste und durfte, dass das Thema intersektionale Mobilitätswende nicht nur größer ist als ich, sondern auch zu meiner Mission wurde. Im Guten wie im Bösen kann ich mir aktuell nichts anderes vorstellen, als an dieser täglich zu arbeiten. Ich berichte euch daher auch von den Herausforderungen, die so ein „Amt“ finanziell, mental und persönich mit sich bringt. Teile euch meine Gedanken und Ideen, 2024 eine finanzielle Grundlage zu schaffen, die es mir erlaubt, direkt vor Ort, am liebsten ländlich beginnend die Mobilitätswende zu starten. Mein Netzwerk und meine Ideen in die Fläche zu bringen. Denn für die Mobilitätswende braucht es keine Bundespolitik, diese folgt uns, wenn wir zur Massenbewegung werden und uns aus der Autodiktatur befreien, um uns echter Freiheit zuzuwenden: Der Freiheit, mit jedem Verkehrsmittel sicher und komfortabel unterwegs sein zu können. Meine Antreiberin ist nicht (nur) die Klimakatastrophe, sondern die schreiende Ungerechtigkeit in unserem völlig auf das Auto zentrierten Verkehrssystem. Das, was wir vorfinden, von einer maroden Bahn, fehlenden Radwegen bis hin zu Milliardensubventionen nur für Autos ist politisch gewollt und kein Naturzustand. Und das ist die gute Nachricht: Das können wir verändern! Die Veränderung kommt von uns, durch uns, mit uns. Sehr regional und lokal beginnend und dann immer weitere Kreise ziehen. Wer will ich gewesen sein und wie will ich in Zukunft leben? Diese Fragen gilt es ehrlich zu beantworten. Mal ehrlich: Wenn du all die Zeit, die du aktuell noch im Auto verbringen musst, ein Lenkrad haltend, mit deinen dir lieben Menschen verbringen könntest, würdest du das Auto dennoch behalten wollen? Oder wäre dir Mobilität lieber, die dir Zeit und Geld spart, dich selbstbestimmt mobil sein lässt und Kindern Spielen vor der eigenen Haustür erlaubt? Mobilitätswende ist weiter mehr als nur die Veränderung von Antrieben. Sie ist die Chance auf eine neue gerechte Gemeinschaft Für Barrierefreiheit oder zum Sprachen lernen: Hier findet ihr das vollständige Transkript zur Folge: Hier gehts zum Transkript Transkription unterstützt durch AI Algorithmen von Presada (https://www.linkedin.com/company/presadaai/)…
s
she drives mobility
1 Wie gehen wir trotz der Dunkelheit aus 2023 mit Hoffnung in das neue Jahr hinein, Tadzio? 1:14:20
1:14:20  التشغيل لاحقا
التشغيل لاحقا  التشغيل لاحقا
التشغيل لاحقا  قوائم
قوائم  إعجاب
إعجاب  احب1:14:20
احب1:14:20
Das erste Mal muss ich wohl eine gewisse Triggerwarnung aussprechen, bevor ihr diese Folge hört. Mein Freund Tadzio Müller, mit dem ich diese letzte Folge She Drives Mobility 2023 gestalte, neigt bekanntermaßen zu sehr deutlicher Sprache 🙂 Wenn dir diese oder auch eine andere Folge gefällt, lass´ gern eine Bewertung da und/oder supporte mich per Ko-Fi oder PayPal . Meinen wöchentlichen Newsletter gibt es bei steady . Mein zweites Buch „ Raus aus der AUTOkratie – rein in die Mobilität von morgen! “ kann ab sofort vorbestellt werden. Ich freue mich, wenn du das machst, denn das hilft nischigen Sachbüchern wie dem meinen, wahrgenommen zu werden. Ihr wisst schon: Kapitalismus – Carpitalism – und dann erst das Paradies für alle. Tadzio und ich haben diese Folge online vor den Augen und Ohren knapp 60 von unseren steady-Abonnent:innen aufgenommen, mit denen wir dann im Anschluss „off the records“ noch weiter persönliche Erfahrungen und Fragen besprochen haben. Wir feilen grad an einem Konzept, dieses Format einmal im Monat für unsere Abonnent:innen zu verstetigen. Stay tuned. 🙂 Wir beginnen mit dem Ereignis, das 2023 ziemlich schnell in Aktion geraten ließ: Die Räumung von Lützerath. Für Tadzio waren diese Tage vor der Zerstörung dieses Dorfes in einem der Reihenhäuser wohnend DER Moment, in dem er sich aus seinem ganz persönlichen Dunkel befreien konnte, das sich zuvor aufgebaut hatte, weil er nicht mehr an die Klimabewegung geglaubt hatte, die seine „Religion“ war. Ich wiederum hatte bereits Sekunden nach Abfahrt mit „meinem“ Bus gen Lützerath die erste Begegnung mit Polizeirepression, die letztlich dafür sorgte, dass wir die Demonstration verpassten, zu der wir gemeinsam fahren wollten. Für Tadzio ist das beständige Eingeschränktsein in seinen Freiheitsrechten sehr viel mehr Teil seines linksradikalen Seins als es das meine bisher sein konnte, weil ich nicht zu den radikalen Linken gehöre. Seiner Beobachtung nach änderte sich das mit der Besetzung des Hambacher Forstes, wo sich die Legitimierung der Proteste änderte, „mittiger“ akzeptiert wurde. Lützerath war seiner Beobachtung nach ein Kristallisationspunkt auch für die Klimabewegung, radikaler zu agieren. Einen symbolischen und realen Ort zu verteidigen gegen fossile Konzerne und eine Staatsgewalt, die gegen Klimaschutz verstößt. In einer politischen Landschaft, in der verschiedene Bundesländer Polizeigesetze erlassen haben, die sich gegen „Terrorismus“ richten, aktuell aber nur gegen Klimabewegung zur Anwendung kommen. Stichwort Präventivhaft und eben das Erlebnis mit meiner Busfahrt. Bisher waren Klimaaktivist:innen „beliebt“, wurden als „auf der richtigen Seite stehend“ wahrgenommen, Tadzio nahm hier 2023 eine zunehmende Abwertung bis Delegitimierung der Bewegung wahr, die bis heute nicht nur anhält, sondern sich immer wieder steigerte. Doch obwohl Lützerath als Dorf fiel und von der Landkarte gefegt, war Tadzio nach diesem Ereignis „aufgetankt“ – mit einer Kraft, die ihn durch das ganze Jahr getragen hat. Für mich war Lützerath der Beweis, dass, wenn ein Land (oder eine Region) in den Krisenmodus gerät, problematische Dinge auf Seiten der Polizei, der Medien geschehen. Und ein Ort, der mich mit Menschen zusammenführte, denen ich so nie begegnet wäre. Indigenen, die in Chile neben riesigen RWE-Minen leben müssen, Autonome, die jenseits von Lohnarbeits- und Miete-zahlen-Lebensläufen existieren. Für Tadzio sind die Orte, wo sich die Bewegung trifft, weiterhin immer die besten Orte, weil dort Energie entsteht und in eine Richtung gegangen wird – auch wenn es auch in der Bewegung natürlich Konflikte gibt. Ein nächster Punkt, den wir vertieft haben, ist die öffentliche Debatte und vor allem das Niveau von dieser. Tadzios Highlight: Friedrich Merz und seine Definition von „CO2 als Chance“. Die Distanz zwischen dem, was in der Welt geschieht in Sachen Klimakatastrophe und dem, was an Narrativen statuiert wird, klafft immer weiter auseinander. So auch die Meldung, dass auf der COP28 der Ausstieg aus den fossilen Brennstoffen beschlossen wurde. Was de facto unmöglich ist, weil dort nur Wörter gewechselt werden. Aber keine Maßnahmen, die wirklich hart greifen und nach dem Ende der Konferenz zu ersten merklichen Effekten führen. Tadzio ordnet vertiefend die Rolle der Klimakonferenzen in der Vergangenheit ein – und damit auch die COP28 in Dubai. Für Tadzio war diese Klimakonferenz aber auch Zeichen dafür, dass Teile der gemäßigten Klimabewegung mittlerweile Teil dieser Konferenzen sind und diese nicht mehr hinterfragen. Für Tadzio ist damit die einst große Klimabewegung sehr zusammengeschrumpft auf letztlich nur noch die radikalen Flügel, weil diese noch für Kommunikationsanlässe und das Hinterfragen des politischen Tuns sorgen – nicht jedoch mehr Bewegungen wie FFF. Die Letzte Generation wurde 2023 von Tadzio sehr auch in Sachen Öffentlichkeitsarbeit unterstützt, war jedoch ebenfalls nicht erfolgreich. Da die Gesellschaft aktuell in Verdrängung der Folgen der Klimakatastrophe und damit nicht empfänglich für rationale Darstellung ist. Das Fazit von 2023 ist für Tadzio, dass die Breite der Gesellschaft schlicht genervt von jedweder Klimabewegung ist – sich nicht verändern will und rational nicht zugänglich sei, um Verantwortung im Sinne auch des Hinterfragens des eigenen Lebensstil zu akzeptieren. Als Politikwissenschaftler schaut er natürlich auch systemischer auf solche Entwicklungen. So auch auf Sprache, was ist sagbar, was macht den aktuellen Rechtsruck aus, welche Bedeutung übernahmen hier Menschen wie Claudia Pechstein und Hubert Aiwanger? Tadzio fand hier die Metapher des „Coming Out“, nicht im Sinne, wer wen wie liebt, sondern in dem Sinne, dass die Masken fallen bei Jenen, die bisher noch als bürgerliche Mitte missgelesen wurden, aber mittlerweile nicht nur AfD wählen, sondern auch AfD ohne jede Scham sprachlich in der Öffentlichkeit sind. Und die Grenzen zwischen dieser Partei und anderen Parteien schwammiger werden lassen. Hier gibt es eine offen gelebte Schamfreiheit, die sich in 2023 immer weiter steigerte und in immer größeren Stimmanteilen für diese Partei sich widerspiegelte. Für Barrierefreiheit oder zum Sprachen lernen: Hier findet ihr das vollständige Transkript zur Folge: Hier gehts zum Transkript Transkription unterstützt durch AI Algorithmen von Presada (https://www.linkedin.com/company/presadaai/)…
مرحبًا بك في مشغل أف ام!
يقوم برنامج مشغل أف أم بمسح الويب للحصول على بودكاست عالية الجودة لتستمتع بها الآن. إنه أفضل تطبيق بودكاست ويعمل على أجهزة اندرويد والأيفون والويب. قم بالتسجيل لمزامنة الاشتراكات عبر الأجهزة.